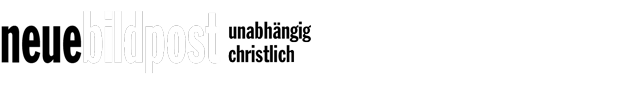Liebe Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonalen Dienst,
liebe Schwestern und Brüder,
wussten Sie, dass der hl. Ulrich als Säugling an einer besonderen Form der Laktose-Intoleranz litt? Mir fiel dieser Umstand bei der Vorbereitung der Predigt erstmals auf, als ich in der ältesten Lebensbeschreibung blätterte, der Vita Sancti Uodalrici des Dompropstes Gerhard von Augsburg, die 993 im Todesjahr des Heiligen auf einer Lateransynode in Rom verlesen wurde und zur Kanonisation des Bischofs durch Papst Johannes XV. führte.
Als im Dezember vergangenen Jahres das päpstliche Jubiläumsschreiben zum 150. Jahrestag der Erhebung des hl. Josef zum Schutzpatron der Kirche veröffentlicht wurde, war für mich klar: Gerade jetzt, während dieser verheerenden Pandemie, die weltweit nicht nur Gesellschaften und Unternehmen, Betriebe und ganze Volkswirtschaften beutelt, sondern vor allem in den Familien ihre zerstörerische Kraft gezeigt hat und immer noch zeigt – gerade jetzt ist es notwendig, dass wir uns als Christen stärken lassen durch die Vorbilder, die uns Geschichte und Gegenwart vor Augen führen. Deswegen habe ich mich entschieden, die diesjährige Ulrichswoche unter eben jenes Motto zu stellen, das Papst Franziskus als Titel für sein Schreiben gewählt hat: „Patris corde – mit dem Herzen eines Vaters.“ Ich kann Ihnen allen, und besonders den Männern und Vätern unter Ihnen, die Lektüre dieses kurzen, aber inhaltsreichen Textes herzlich empfehlen. Unser Heiliger Vater offenbart darin einmal mehr, wo er für sich selbst die Kraft nimmt für seine große Aufgabe des steten Ausgleichschaffens zwischen den Extremen und der weltweiten Ungleichzeitigkeit!
Tatsächlich kann der Nährvater Jesu durch seine besondere Stellung innerhalb der Heiligen Familie für viele, ganz unterschiedliche Lebensentwürfe Ansporn und Beispiel sein. Daher möchte ich ausdrücklich ermutigen, sich nicht vordergründig am Mann-Sein des hl. Josef zu orientieren, als ob das Geschlecht eines heiligen Menschen maßgeblich für seine Verehrung wäre und nur Frauen den Frauen und Männer ihresgleichen etwas zu sagen hätten. Das wäre geradezu aberwitzig und widerspräche allem, was wir durch die fast 2000jährige Beschäftigung mit der frohen Botschaft des menschgewordenen Wortes Gottes gelernt haben!
So sehe ich es mit großer Sorge, wenn manche Diskussionen und Streitgespräche, die heute lautstark geführt werden, zu solch widersinnigen Engführungen neigen. Es gibt eine Frauenkirche – den Liebfrauendom in München; aber eine Kirche aus Frauen gegen eine Männerkirche zu stellen, bringt uns nicht weiter. Ziel ist eine geschwisterliche Kirche. Als Christinnen und Christen wissen wir uns dem Wort des Völkerapostels Paulus verpflichtet, der in ähnlich hitzigen Debatten um Zugehörigkeit und Ausschluss das Gemeinsame betonte: „Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr seid einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28).
Allen, die jetzt denken: welch schöne Utopie – stimme ich voll zu: Ja, Sie haben recht, auch nach 2000 Jahren sind wir noch weit von der Verwirklichung dieses Ideals entfernt! Aber das darf uns nicht entmutigen: Zeigen wir unseren Glauben, das Festhalten am Evangelium, gerade durch eine unbeirrbare Treue zum Gott und Vater Jesu Christi und treten wir freudig und beherzt in die Fußstapfen derer, die uns auf dem Weg mit großen Schritten vorangegangen sind!
Beim hl. Ulrich darf man das ganz wörtlich nehmen: Er überragte mit einer Körpergröße von 1,80 bis 1,90 Meter die meisten seiner Zeitgenossen um mehr als Haupteslänge. Und das ist keine Vermutung von mir, sondern das Ergebnis der wissenschaftlichen Untersuchung seiner Gebeine, die man 1971 anstellte. Als stattlicher Mann von „hohem Bildungsstand“ (doctrinae suae scientiam) – so tritt der etwa 30jährige schwäbische Adelige nach dem Tod des Augsburger Bischofs Hiltine im Jahre 923 vor König Heinrich und überzeugt den damaligen ‚Bischofsmacher‘, der ihm das „Handgelöbnis“ abnimmt und damit den Weg für die Bischofsweihe am Fest der Unschuldigen Kinder freigibt (Vita I, 1, 117ff).
Doch was auf den ersten Blick so bruch- und reibungslos aussieht, war ganz und gar nicht selbstverständlich. Denn der kleine Uodalricus litt, ich sagte es eingangs schon, seit Geburt an einer Krankheit, die seinen Eltern Rätsel aufgab: „Er wurde in gewohnter Weise gestillt und mit allem Eifer genährt; doch obwohl er einen hübschen Körperbau zeigte, war er so mager, dass sich seine Ernährer (nitritores) schämten, wenn irgendein Unbekannter sein Gesicht betrachtete“, heißt es zu Beginn der Vita (I,1, 6ff). Zwölf Wochen bleiben die Eltern ratlos, bis sie einen Kleriker zu Gast haben, der das Kind in der Kammer nebenan wimmern hört. Er empfiehlt, den Knaben abzustillen und ihm andere Kost zu geben. Es braucht einige Tage und den ernsten Hinweis auf die Todesgefahr, in der das Kind schwebt, bis die Eltern dem lebensrettenden Rat folgen.
Unklar bleibt, woher der Unbekannte sein Wissen hatte. Doch können wir sagen: Er handelte „mit dem Herzen eines Vaters“ und brachte endlich auch die Eltern Ulrichs dazu, sich von ihrer festgefahrenen Meinung und den üblichen Gepflogenheiten zu lösen. Sie müssen lernen, das Defizit ihres Kindes zu akzeptieren, damit sie ihm die Pflege geben können, die es braucht. Eine unscheinbare, aber doch kostbare Episode aus Bischof Ulrichs frühester Kindheit, finden Sie nicht auch? Ulrichs Eltern haben ihrem Sohn wohl von ihrer Not und ihrer Dankbarkeit über den rettenden Hinweis berichtet; er selbst hielt später die Geschichte für so bedeutungsvoll, dass er sie mit seinem Freund, dem Dompropst Gerhard, teilte.
Bestimmt gilt: Wer so früh in Lebensgefahr schwebte, der ist davon geprägt und weiß um die Zerbrechlichkeit und Herrlichkeit des Lebens – und hat vielleicht gerade deswegen mehr Sensibilität und Empathie für das Leid anderer!
Wir sind es gewohnt, uns Bischof Ulrich als „Streiter in Not“, entschlossen und durchsetzungsfähig, ehrfurchtsheischend und gebieterisch, kurz: als imposante Persönlichkeit, zu denken. Gerade die Bildhauer unter den Künstlern förderten diese Vorstellung; erinnern wir uns z.B. an die Skulptur ‚Bischof Ulrich hoch zu Ross‘ über dem Dombrunnen. Zweifellos: Während seiner 50jährigen Amtszeit hat er sicher all diese Eigenschaften gezeigt. Aber eben nicht nur: Die älteste Biographie legt Wert darauf, seine fürsorgliche, liebevolle Seite darzustellen.
Nach Schul- und Studienzeit bei den Benediktinern in St. Gallen tritt Ulrich in den Dienst des Augsburger Bischofs Adalpero, lässt dabei aber nie den Kontakt zu seiner Familie abreißen. Als er eine Pilgerreise nach Rom unternimmt und dort vom Papst höchstpersönlich erfährt, dass sein Bischof inzwischen verstorben ist und er, Ulrich, „nach Gottes Willen“ sein Nachfolger und „Hirt der Domkirche“ (matriculae pastor I,1, 94) sein solle, lässt ihn die Trauer über Adalpero den Dienst am bischöflichen Hof quittieren und zu seiner inzwischen verwitweten Mutter zurückkehren, um für sie zu sorgen (tanta diligentia 108).
15 Jahre später, nachdem er selbst Bischof geworden war, behielt er seinen asketischen Lebensstil, den er in St. Gallen gelernt hatte, bei, war aber gleichzeitig äußerst freigebig gegenüber den Bedürftigen: „Bei den täglichen Mahlzeiten“, so wird berichtet, „wurde das erste Gedeck mit Broten und Speisen (…) zum größten Teil unter die Armen verteilt, - die Verstümmelten und Gebrechlichen ausgenommen, die auf Ruhe- und Tragbahren lagen, auf Schemeln liefen und in Rollbetten ihren täglichen Lebensunterhalt in seiner Gegenwart empfingen“ (I, 1, 78-84).
Das heißt im Klartext: Bischof Ulrich hat die Ärmsten der Armen in seine unmittelbare Nähe eingeladen! Lange vor dem hl. Franziskus, der das Leben mit den Aussätzigen vor den Toren Assisis teilte, nahm Ulrich die Randständigen in die Mitte, gab ihnen damit buchstäblich An-Sehen und stärkte ihre Würde.
Weiter lesen wir: „Mönche aber, Kleriker und Nonnen, die ihn besuchten, liebte er wie leibliche Kinder (more filiorum amavit) und erfrischte sie überreich mit geistlichen und leiblichen Speisen“ (I, 1, 78-84; 99-101).
„Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr“: Wilhelm Busch hat es auf den Punkt gebracht. Vater sein ist schwer, denn man bleibt es ein Leben lang. Es ist mit Verantwortung und Vorbild verbunden, selbst für den, der wie Bischof Ulrich keine eigenen Kinder hatte, aber seinen bischöflichen Dienst als geistliche Vaterschaft begriff. – Kann man, darf man einen solchen Begriff angesichts der zahlreichen Missbrauchsfälle und so vieler Vertrauensbrüche, die in unserer Kirche von Männern und Frauen, von Klerikern, Ordensleuten und Mitarbeiter/-innen geschehen sind, überhaupt noch in den Mund nehmen?
Ich meine „Ja“, auch wenn es mir schwerer über die Lippen geht als noch vor Jahren. Wir dürfen über all dem Furchtbaren, von dem wir wissen, die frohe, befreiende Botschaft nicht verschweigen. Wir dürfen als Gläubige nicht verstummen, sondern müssen im Gegenteil auf das Gute und Gelingende, Lebensfördernde und Befreiende in unserem Glauben und bei denjenigen hinweisen, die ernst machen mit der Nachfolge Jesu.
Gerade die Empathischen und Einfühlsamen unter uns möchte ich ermuntern: Erzählen Sie von beglückenden Erlebnissen, von Gotteserfahrungen, die ihr Leben in die Tiefe führten, von Menschen, die selbstlos und großherzig sind, die verantwortungsbewusst und mutig für andere eintreten. Denn darin liegt die geistliche Elternschaft, die jede und jeder von uns einüben kann: Der nächsten Generation Raum geben, ihr Achtung und Interesse entgegenbringen, sie weder von sich abhängig machen oder manipulieren noch sie völlig ihrem Schicksal überlassen.
Die Pandemie zeigt uns verstärkt, was Erzieher/-innen und Jugend- und Sozialarbeiter/-innen seit Jahren mit Sorge erfüllt: die Gewalt gegen Kinder (und Schutzbefohlene aller Art) nimmt zu. Dies hängt auch mit dem Männerbild in unserer Gesellschaft zusammen. Zwischen denen, die eine traditionelle Rollen- und Arbeitsverteilung verinnerlicht haben, und jenen, die als sog. moderne Väter Kindererziehung vom ersten Tag an möglichst zu gleichen Teilen wie die Mütter erleben wollen, ist die Mehrheit der Väter verunsichert.
Ein deutliches Zeichen, dass sich unsere Gesellschaft im Umbruch befindet! Doch in jeder Krise, die als solche erkannt wird, liegt auch eine Chance. Als Christen, die ihr Vertrauen in die liebende Begleitung Gottes setzen, sind wir aufgerufen, in Umbrüchen den Impuls zu Aufbruch und Wandlung zu erkennen. Hier kann uns wieder der hl. Josef ein sprechendes Vorbild sein. Viermal durchkreuzten Träume seine Lebenspläne – und er hat sich nicht verweigert. Er hat sich nicht der Verantwortung entzogen, sondern ließ sich „von den Träumen leiten (…), weil“, wie Papst Franziskus in seiner Botschaft vom diesjährigen Josefsfest ausführt, „sein Herz auf Gott ausgerichtet war, Ihm gegenüber schon (längst) bereit war. Seinem wachsamen ‚inneren Ohr‘ genügte ein kleiner Hinweis, um Gottes Stimme zu erkennen. Das gilt auch für unsere Berufungen: Gott liebt es nicht, sich auf spektakuläre Weise zu offenbaren und so unserer Freiheit Gewalt anzutun. (…) Er blendet uns nicht mit strahlenden Visionen, sondern wendet sich feinfühlig an unser Inneres, er macht sich uns vertraut und spricht zu uns durch unsere Gedanken und Gefühle.“ Soweit die Worte des Papstes.
„Gott macht sich uns vertraut“ – welch wunderbares Bild! Wie sehr wünschte ich, dass immer mehr Menschen ein solches Gottesbild hätten! Denn das ist der Gott, den uns sein Sohn Jesus Christus verkündete, zu dem er seine Jüngerinnen und Jünger „Abba, Vater“ sagen lehrte (Mk 14, 32; Röm 8,15; Gal 4,6).
Vor diesem Hintergrund schließt sich auch das Evangelium des heutigen Tages auf. Die Jesus Christus folgen, müssen sich unterscheiden von den „Herrschern“ und den „Großen“ (Mt 20, 25). Geschwisterlichkeit und Dienst als „konkreter Ausdruck der Selbsthingabe“ heißen daher die Wegweiser, die Jesus aufstellt. Er selbst ist diesen Weg bis zum Äußersten gegangen. Er wurde unter die Verbrecher gezählt und draußen, vor der Stadt, auf der Schädelhöhe gekreuzigt.
Ulrich lebte in einer Zeit, in der die Bevölkerung seines Bistums noch weithin von schwerer körperlicher Arbeit in der Landwirtschaft geprägt war und bedroht von Krankheit und Krieg. Er hielt nicht Hof, wie für Adelige damals üblich, sondern war unermüdlich unterwegs zu den Menschen, feierte Gottesdienst und spendete Sakramente. Oft waren es weniger materielle Güter, die er brachte, als vielmehr: Glaube, Hoffnung und Liebe. Mit gewinnender Heiterkeit (dulcedo hilaritatis) und beeindruckender Frömmigkeit (religio sanctitatis), so sein Biograf, baute er in den Herzen wieder auf, was durch feindliche Überfälle in den Dörfern und Klöstern zerstört worden war (vgl. I, 15,8ff).
Daher bliebe das Gedenken an ihn heute an seinem Todestag unvollständig, wenn wir nicht beherzigen, was schon Dompropst Gerhard an den Schluss seines Mirakelbuches gestellt hat: „Ahmen wir den, von dem wir reden, mit Gottes Hilfe nach und beschreiten wir mit seiner (fürbittenden) Unterstützung den Weg der Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit (iter rectitudinis), um einst DEN zu erreichen (…), der in drei Personen (…) EINER ist, den allmächtigen und unwandelbaren Gott (…). Amen.“