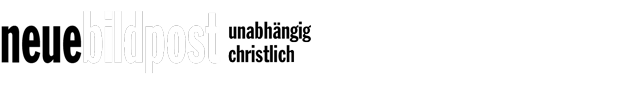Jerusalem könnte zu einem Symbol der Versöhnung und Hoffnung werden.“ So war das Interview überschrieben, das der israelische Journalist Uri Avnery mit Albert Aghazarian im Januar 1996 führte. Der Historiker, der 1991 bei der Nahostkonferenz von Madrid Leiter des palästinensischen Pressebüros war, zeigte sich überzeugt: Bei einer für beide Seiten annehmbaren Lösung des Nahostkonflikts würden sich „alle anderen Teile des heiklen Friedenspuzzles wie von selbst zusammenfügen“.
Acht Monate später flog das Puzzle in die Luft und landete mit noch mehr Teilen auf dem Boden. Ende September 1996 ließ der kurz zuvor erstmals zum Premierminister gewählte Benjamin Netanjahu im muslimischen Viertel der Jerusalemer Altstadt, gegenüber dem Startpunkt der christlichen Via Dolorosa, den Ausgang zu einem archäologischen Tunnel eröffnen. Der Zugang zu demselben befindet sich neben der Klagemauer. Darüber erhebt sich der Tempelberg.
Angriff auf die drittheiligste Stätte ihres Glaubens
Die Palästinenser sahen in Netanjahus Anordnung einen Angriff auf die drittheiligste Stätte ihres Glaubens, auf die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom, und reagierten mit gewalttätigem Protest. Drei Tage bewaffneter Zusammenstöße folgten: in Jerusalem, im Westjordanland und im Gaza-Streifen. Je nach Quelle kosteten die Kämpfe zehn bis 15 Israelis und 60 bis 80 Palästinensern das Leben.
„Wider die Vernunft eröffnete die israelische Regierung einen historischen Tunnel für Touristen und zementiert damit eigene Machtansprüche in Jerusalem“, schrieb die gewöhnlich israelfreundliche Wochenzeitung „Die Zeit“. Die Kraftprobe mit den Palästinensern drohe den Friedensprozess zu beenden. „Gefährliches Roulette am Tempelberg“ war der Beitrag von Gisela Dachs betitelt.
Ein Blick in die Geschichte zeigt: Die sogenannten Tunnelunruhen im September 1996, vor 25 Jahren, waren weder die erste noch die letzte Eskalation der Gewalt zwischen Juden und Palästinensern, die an einer heiligen Stätte oder anlässlich eines religiösen Feiertags begann. Bereits 1920 löste das muslimische Nabi-Musa-Fest Auseinandersetzungen mit zahlreichen Toten und Verletzten aus.
Nabi Musa bedeutet im Arabischen „Prophet Mose“. Bei dem Fest ziehen alljährlich Tausende in einer Prozession von Jerusalem in die judäische Wüste wenige Kilometer vor Jericho, wo nach muslimischer Tradition das Grab Mose verehrt wird. 1920 fiel dieser Tag mit dem jüdischen Pessachfest und dem griechisch-orthodoxen Osterfest eng zusammen.
Auslöser für Gewalt konnte nie festgestellt werden
Der deutschstämmige israelische Historiker Tom Segev widmet Nabi Musa in seinem Buch „Es war einmal ein Palästina“ ein ganzes Kapitel, berichtet von einer aufgeheizten Stimmung, patriotischen Reden der palästinensischen Araber und rhythmischen Rufen wie „Palästina ist unser Land, die Juden sind unsere Hunde“. Letztlich stellt er aber fest: „Der eigentliche Auslöser für die Gewalttätigkeiten konnte niemals genau festgestellt werden.“
Jedenfalls kam es zu pogromähnlicher Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung. Mit Messern, Knüppeln und Schusswaffen ausgestattete palästinensische Banden plünderten, verheerten, vergewaltigten und mordeten. Fünf Tote und über 230 Verletzte auf jüdischer, vier Tote und 24 Verletzte auf palästinensischer Seite lautete die Bilanz. Dazu kamen sieben verwundete Soldaten.
Startschuss für den Kampf
Der britischen Mandatsmacht, allen voran Ronald Storrs als Militärgouverneur der Stadt, wurde in Folge so ziemlich alles vorgeworfen: von Passivität über das Schüren der Spannungen bis hin zur Organisation des Pogroms. Die Unruhen ereigneten sich unmittelbar vor der Konferenz von San Remo, die das Schicksal der Region für die folgenden Jahrzehnte besiegelte. Tom Segev bezeichnet die Ausschreitungen als „Startschuss für den Kampf um das Land Israel“.
Das Jahrhundert, das seit Nabi Musa vergangen ist, hat wiederholt gezeigt: Die Zündschnur des jüdisch-palästinensischen Unfriedens ist gerade an heiligen Stätten denkbar kurz. Beispiele sind der Ausbruch der zweiten Intifada im Herbst 2000 oder der jüngste israelische Krieg gegen Gaza vor vier Monaten. Damals rechtfertigte Hamas-Mitglied Hamza Abu Shanab den Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen so: Der Feind sei derjenige, „der die Zündschnur anzündete, indem er Palästinenser am Gebet in der al-Aqsa-Moschee hinderte.“
Ist der Konflikt also ein religiöser? Rainer Zimmer-Winkel, katholischer Theologe, war gut drei Jahre lang Regionalkoordinator im Rahmen des Zivilen Friedensdienstes in Jerusalem. Er ist wütend angesichts der „Fast-Totalität, in der Religion heute als Teil des Konflikts und nicht als Teil der Lösung“ wahrgenommen werde. Religion werde als „konfliktverschärfendes statt konfliktveränderndes Element“ gesehen.
„Dass es nicht gelungen ist, hier etwas anderes deutlich zu machen“, urteilt er, „ist ein Armutszeugnis für die religiösen Gemeinschaften“ des Heiligen Landes.
Johannes Zang