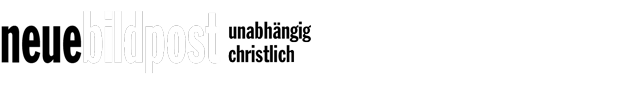Konzentrationslager – allein die Bezeichnung lässt schaudern. Für viele Gegner des NS-Regimes, die in einem der zahlreichen KZs einsaßen, waren sie Orte des Grauens. Willkür und Gewalt waren an der Tagesordnung. Hoffnung gab manchem Häftling die Religion. Ja, selbst in Lagern und Haftstätten des NS-Regimes wurde gebetet, gab es ein geistliches Leben. Die Forschung dazu steht noch am Anfang.
Die ersten polnischen Soldaten, die nach dem Kriegsbeginn am 1. September 1939 ins Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager Stalag X B nach Sandbostel kamen, begannen sogleich mit dem Aufbau einer eigenen Gemeinde. Sie gestalteten in einer Baracke sogar ihren eigenen Kirchenraum zum täglichen Gebet und Gottesdienst.
„Allabendlich um etwa 21 Uhr singen sie in ihren Baracken ein Abendlied, morgens nach dem Aufstehen ein Morgenlied. In Andachten stehen sie in ihren Betten.“ So beschreibt ein deutscher Wachmann den Glauben der polnischen Katholiken im Lager.
Nach den Bestimmungen der Genfer Konvention und der Haager Landkriegsordnung musste den Kriegsgefangenen eine offene religiöse Betätigung ermöglicht werden. Das erkannten auch die Nazis an. Liturgische Geräte, Bibeln und Gebetsbücher, Messwein und geweihte Hostien brachten etwa das Rote Kreuz oder der CVJM zu den Soldaten.
Die ausländischen Hilfsorganisationen begutachteten auch die Lager. Das war den Nazis ganz recht, konnten sie doch auf diesem Weg der ganzen Welt demonstrieren, wie gut das „Dritte Reich“ mit seinen Gefangenen umging. Dass dies nicht unbedingt für sowjetische Soldaten galt und auch das Rote Kreuz wenig Interesse zeigte, die mit Rotarmisten überfüllten Lagerbereiche zu besuchen, gehört zu den kaum erforschten Aspekten der NS-Geschichte, sagt der Leiter der Gedenkstätte Sandbostel, Andreas Ehresmann.
Muslime praktizierten ihren Glauben
Soldaten der Roten Armee wurden in deutschen Kriegsgefangenenlagern in der Regel schlechter behandelt als Angehörige anderer Streitkräfte. Dennoch wurde offensichtlich bestimmten Rotarmisten eine gewisse Freiheit gewährt, weiß Ehresmann: „Muslimen war es durchaus erlaubt, ihre Gebete auszuführen. Sie konnten auch einen Imam bestimmen.“ In den asiatischen Sowjetrepubliken, insbesondere bei Usbeken, Turkmenen und Tadschiken, gab es viele Muslime, die ihren Glauben praktizierten.
In dem Bereich des Lagers, der für französische Kriegsgefangene vorgesehen war – unter ihnen zahlreiche Muslime aus Nordafrika –, sei der Ruf des Muezzin zu hören gewesen. Indizien sprechen laut Ehresmann sogar dafür, „dass in der Lagerküche auf muslimische Gläubige Rücksicht genommen wurde. Das heißt, dass zum Beispiel kein Schweinefleisch verwendet wurde.“
Kaum Thema gewesen
Ob den Muslimen demonstrativ mehr Freiräume zugestanden wurden, um mit ihnen im Krieg vor allem in Nordafrika neue Allianzen schmieden zu können, ist bislang nicht erforscht. Auch sonst ist die Religiosität in Lagern des NS-Regimes kaum Thema der Geschichtsforschung gewesen.
Eines scheint aber schon jetzt klar zu sein: Die Nazis achteten zumindest in den Kriegsgefangenenlagern das Recht auf freie Religionsausübung – und das sogar dann, wenn es sich um jüdische Offiziere und Soldaten handelte.