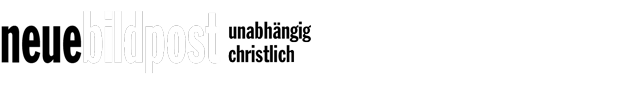2021 soll ein wichtiges Jahr für die Ökumene werden. Jedenfalls wünschen sich das die Organisatoren des Ökumenischen Kirchentags im Mai in Frankfurt, wenn auch die Planungen dafür coronabedingt angepasst werden müssen. Bischof Gerhard Feige aus Magdeburg, der Ökumene-Verantwortliche der Deutschen Bischofskonferenz, hält das Treffen für einen „Gradmesser“ im Miteinander der Konfessionen. Im Interview spricht er über Perspektiven für ein gemeinsames Abendmahl und den hier und da auftretenden „begrenzten Dissens“ zwischen den ökumenischen Partnern.
Bischof Feige, Sie hatten im Dezember einige ökumenische Konferenzen. Was meinen Sie: Wie ist die ökumenische Großwetterlage?
Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, denn die Ökumene ist komplex und kompliziert. Es gibt Unterschiede zwischen offiziell und inoffiziell, national und international, amtlich und persönlich, theologisch und pastoral. Aber wenn ich es zusammenfassen soll, würde ich sagen: Insgesamt gab es schon einmal erfreulichere Phasen.
Was ist denn im Moment weniger erfreulich?
Wenn wir mal das Verhältnis zur Orthodoxie nehmen: Da gab es vor Jahren, als etwa 2006 der theologische Dialog zwischen uns wieder aufgenommen wurde, hoffnungsvolle Aufbrüche. Das ist jetzt viel schwieriger durch die Spannungen zwischen den orthodoxen Kirchen, etwa durch den Ukraine-Konflikt. Nun könnte man sagen: Was gehen uns innerorthodoxe Konflikte an? Aber sie belasten das katholisch-orthodoxe Verhältnis schon stark.
Erfreulich ist hingegen, dass Papst Franziskus gerade in einer neuen Verlautbarung die Bedeutung der Ökumene gestärkt hat.
Ja. Das ökumenische Vademecum des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit, das mit Zustimmung des Papstes veröffentlicht wurde, stellt deutlich heraus, dass Ökumene nicht nur irgendein kleiner Teilbereich ist, sondern ein wesentlicher Auftrag für die Kirche und besonders für die Bischöfe. Das ist weltweit ein wichtiges Zeichen. Ich bin dankbar, dass für die Kirche in Deutschland das alles ziemlich selbstverständlich ist. Heiße Eisen werden in dem Text allerdings nicht angefasst.
Heiße Eisen wie etwa die gegenseitige Einladung von Katholiken und Protestanten zum Abendmahl – in Deutschland wahrscheinlich der ökumenische Aufreger des vergangenen Jahres. Hat die Debatte das Verhältnis der Kirchen belastet?
Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben kurz vor Weihnachten bei dem Kontaktgespräch zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Rat der EKD natürlich auch darüber gesprochen. Klar ist, dass wir das Votum des Ökumenischen Arbeitskreises, dass eine gegenseitige Einladung schon jetzt möglich ist, gemeinsam würdigen, dass wir Fortschritte sehen. Klar ist aber auch, dass wir noch Fragen haben und dass wir im Detail unterschiedliche Positionen einnehmen.
Was heißt das konkret?
Für die Kirchen der EKD stellt es kein Problem dar, katholische Christen in ihren Gottesdiensten zum Abendmahl einzuladen. Wir können das umgekehrt nicht, jedenfalls nicht offiziell und generell. Allerdings sehen wir als katholische Kirche in Deutschland durchaus Spielraum für die persönliche Gewissensentscheidung des Einzelnen. Anders als das das römische Papier angedeutet hat.
Kann es sein, dass Ihre evangelischen Partner manchmal etwas Mitleid mit Ihnen haben, was die innerkatholischen Konflikte angeht?
Ja, das könnte man vielleicht so sagen. Wir Bischöfe nehmen das auch nicht einfach cool hin, wenn solche Einsprüche aus Rom kommen. Und das spüren die evangelischen Partnerinnen und Partner auch. Wir gehen in unseren Gesprächen sehr einfühlsam miteinander um. Da gibt es keinen persönlichen Schlagabtausch, sondern großes Verständnis für die Probleme der anderen.
Sehen Sie für die nächste Zeit Perspektiven in der Abendmahlsfrage?
Was offizielle Entscheidungen angeht, nicht unbedingt. Aber wir lassen bei der Frage nicht locker. Wir überlegen zum Beispiel, bei einem Studientag die unterschiedlichen Positionen zu diskutieren. Und auch der Ökumenische Arbeitskreis wird eine Entgegnung auf die römischen Einsprüche formulieren. Das Thema ist weiter akut und drängt zu sensiblen Lösungen.
Ist die Basis noch viel ungeduldiger, als die Bischöfe es sind?
Ja, ich glaube schon, dass die Basis noch enttäuschter ist, wenn solche Signale kommen. Andererseits müssen wir auch sehen, dass die Basis durchaus gemischt ist. Es gibt diejenigen, die ökumenisch sehr bewegt sind und denen das alles nicht schnell genug geht. Es gibt aber auch diejenigen, die das ganz anders sehen. Und ich als Bischof muss beides wahrnehmen und kann mich nicht nur auf eine Seite schlagen.
Sie haben angesprochen, dass die katholische und die evangelische Kirche in der Abendmahlsfrage unterschiedliche Positionen haben. Die haben sie aber auch bei anderen Themen. Für Irritationen hat im Herbst die Aussage des hannoverschen Landesbischofs Ralf Meister gesorgt, dass aktive Sterbehilfe auch in kirchlichen Einrichtungen möglich sein müsse. Wie einig sind sich die Kirchen in Sachen Bioethik?
Im Grundsatz sehr einig. Das hat schon vor Jahren eine gemeinsame Studie herausgestellt. In unserem Menschenbild und in unserer Verwiesenheit auf Gott gibt es keine großen Unterschiede. Abweichungen gibt es aber in Einzelfragen. Theologen nennen das einen begrenzten Dissens.