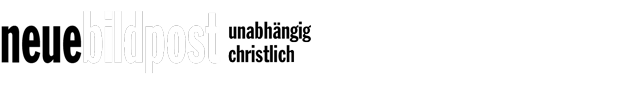Amazonien im September 2013: Ein paar Dutzend Menschen kommen zum Haus der Nonne Geneviève Hélène Boyé, genannt Schwester Veva. Barfuß nähern sich die Apyãwa-Indios der Hütte, mit eigenartig wiegendem Gang, einen langanhaltenden, wimmernden Gesang anstimmend. Im Wohnraum ist ein rechteckiges Loch in den gestampften Lehmboden gegraben worden. Darin liegt der Körper von Veva, eingehüllt in die weiße Hängematte, in der sie jede Nacht zu schlafen pflegte.
Die Zeremonie fand rund 8000 Kilometer von Valfroicourt in den Vogesen entfernt statt, Schwester Vevas kleinem Heimatort im Osten Frankreichs. Die Nonne des Ordens der Kleinen Schwestern Jesu hatte gut 60 Jahre bei dem kleinen Volk am Gebirgszug der Serra do Urubu-Branco im Herzen Brasiliens gelebt. 1952 war sie mit der ersten Gruppe ihres Ordens hierher, in den Nordosten des Mato Grosso, gekommen. Es war ihr Wunsch, nach den Sitten ihrer indianischen Schützlinge bestattet zu werden.
Nachdem die Grube in der Hütte mit Brettern geschlossen ist, streuen die weinenden Frauen Erde darüber. Diese haben sie zuvor nach ihrer Tradition ausgesiebt. Unter den wenigen Nicht-Indigenen, die an dem Ritual teilnehmen, ist Vevas Mitschwester Odile Eglin. Sie erinnert an Worte, welche Geneviève ein Leben lang begleiteten. Sie stammen vom damaligem Stammesältesten der Apyãwa, Cacique Marco.
„Alles hat seinen Preis“
1952, als die ersten der Kleinen Schwestern in die Gegend kamen, herrschte Weltuntergangsstimmung bei den Apyãwa, die damals Tapirapé genannt wurden. „Die Tapirapé werden von dieser Erde verschwinden. Die Weißen werden uns auslöschen“, sagte Cacique Marco. „Alles hat seinen Preis, alles hat seinen Wert, Land, die Jagd, das Fischen. Nur Indios sind wertlos.“ Sein Volk hatte es verinnerlicht, wertlos und unausweichlich zum Aussterben verdammt zu sein.
Das Verhängnis für die Tapirapé, die am gleichnamigen Fluss leben, nahm zu Beginn des 20. Jahrhunderts seinen Lauf, als die ersten weißen Siedler in die Region kamen. Die etwa 2000 Indianer fanden sich im Kontakt mit ihnen Krankheiten ausgesetzt, gegen die sie keinerlei Widerstandskräfte hatten: Grippe, Pocken und Gelbfieber ließen zwei Dörfer aussterben.
Ein weiteres Problem, das zur Dezimierung des Tapirapé-Volks führte, waren kriegerische Auseinandersetzungen mit den Kayapó, welche in derselben Region lebten. 1935 waren die Tapirapé bereits auf 130 Seelen reduziert. Zwölf Jahre später waren sie nur noch 59. Damals kam es zu einem verheerenden Angriff der Kayapó: Während die Männer auf der Jagd waren, wurde ihr Dorf Tampiitãwa fast völlig zerstört und mehrere Frauen und Mädchen entführt.
Beherzte Unterstützung
Gleich bei ihrer Ankunft standen die Kleinen Schwestern den Indigenen beherzt zur Seite. Sie baten um eine Unterkunft im Dorf der Tapirapé an der Mündung des Flusses. Gegründet worden waren die „Irmãzinhas de Jesus“, wie sie in Brasilien heißen, 1939 von der französischen Nonne Magdeleine Hutin in Algerien. Die Ordensgemeinschaft orientiert sich an den Lehren von Charles de Foucauld, dem 2005 seliggesprochen Priestermönch und Eremiten, der im 19. Jahrhundert unter arabischen Nomaden in Nordafrika lebte.
Statt im Umgang mit den Einheimischen vor allem auf die Vermittlung des Glaubens zu setzen, leisteten die Kleinen Schwestern zuerst medizinische Hilfe. So konnte die Säuglingssterblichkeit bei den Tapirapé in kurzer Zeit deutlich gesenkt werden. Die Schwestern übernahmen weitestgehend die Lebensweise der Eingeborenen: Sie lebten im selben Dorf, in ähnlichen Häusern, pflanzten und aßen dasselbe wie sie und nahmen an ihren Ritualen teil.
Für den Orden stand das Ziel im Vordergrund, mit den Indios in Geschwisterlichkeit zu leben: Die Schwestern sollten auf den Feldern mitarbeiten, den Tapirapé im Kampf ums tägliche Maniok beistehen sowie Reis, Mais, Süßkartoffeln und Andu-Bohnen anbauen und ernten. Sie erlernten die Sprache der Indios und ermutigten sie dazu, alles zu leben, was ihren eigenen Traditionen entsprach – einschließlich der Religion. So wurden sie mit der Zeit als Stammesmitglieder anerkannt.
Das Selbstwertgefühl der Tapirapé kam zurück. Durch die Vermittlung der Kleinen Schwestern gelang es, Frauen vom Stamm der Karajá dazu zu bringen, Tapirapé-Männer zu heiraten und ihnen so zu Nachkommen zu verhelfen. Die weit zahlreicheren Karajá lebten am nahen Rio Araguaia. Zuvor hatte es gelegentlich Konflikte mit ihnen gegeben. Dennoch hatte die Aktion der Ordensschwestern Erfolg: Aus den damals 47 Tapirapé sind wieder viele Hundert geworden.