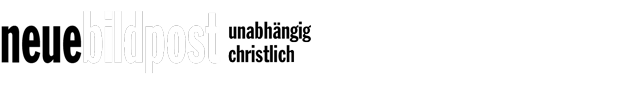Die Ankündigung der Diözesen Fulda, Limburg und Mainz, ihre Bistumszeitungen bis 2023 einzustellen, lässt manchen an ein Ende der konfessionellen Publizistik denken. 1941, ausgerechnet an Pfingsten, war es schon einmal so weit: Alle kirchlichen Zeitschriften mussten auf Anordnung der Nazis ihr Erscheinen einstellen.
Die Nationalsozialisten hatten schon lange darauf hingearbeitet, alles auszuschalten, was nicht in ihr braunes Weltbild passte. Nach der „Machtergreifung“ 1933 wurde schnell der preiswerte Volksempfänger auf den Markt geworfen. Jeder „Volksgenosse“ konnte sich ein Radiogerät leisten – und die „Stimme des Führers“ in jeden Haushalt gesendet werden. Das Hören ausländischer Sender wurde zunehmend erschwert und unter Strafe gestellt.
Auch die kirchliche Presse unterlag der staatlichen Zensur. Missliebige Artikel mussten entfernt werden. Ständig drohte ein Verbot. Dass in der kirchlichen Presse keine Auseinandersetzung etwa mit der Rassenideologie der Nazis stattfand, ist deshalb nicht verwunderlich. Der Zensur entziehen konnten sich nur anonyme Flugschriften. Wer an ihnen mitarbeitete, stand mit einem Fuß im KZ. Der Mut jener Menschen ist bewundernswert.
In den 1920er Jahren war die kirchliche Presse zunächst aufgeblüht. Zahlreiche neue Zeitschriften wurden ins Leben gerufen, um Botschaft und Lehre der Kirche unter einer wachsenden Zahl von Lesern zu verbreiten. In der Nazizeit war ihnen nur noch ein Schattendasein vergönnt. Die aktuelle Berichterstattung war eingeschränkt, der Nachrichtenwert gering. Die katholische Publizistik, gezwungenermaßen auf Kirche und Liturgie beschränkt, führte ein Nischendasein.
Das völlige Verbot der kirchlichen Presse 1941 war nur eine logische Konsequenz. Ziel des Regimes war die weitere Schwächung der Kirche und ihres Einflusses. Offiziell begründet wurde das Verbot mit Papiermangel. Außerdem sollten dadurch Arbeitskräfte für andere Aufgaben frei werden.
Das Verbot trat zum Pfingstfest in Kraft – ausgerechnet zum „Geburtsfest“ der Kirche. Die Herabkunft des Heiligen Geistes befähigte die Jünger, die frohe Botschaft von Jesus Christus, dem Heiland und Erlöser, in alle Welt zu tragen. Im Deutschen Reich dagegen sollten die Jünger Jesu zum Schweigen gebracht werden. Mitglieder der SS wurden aufgefordert, aus der Kirche auszutreten. SS-Führer Heinrich Himmler, ein ehemaliger Ministrant, gab entsprechende Weisungen.