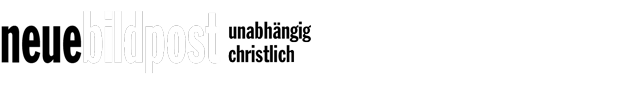Im Streit um das in Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs geregelte Werbeverbot für Abtreibungen ringt die Bundesregierung hinter den Kulissen um einen Kompromiss. Linken, Teilen der Grünen und Feministinnen geht es um mehr: Sie wollen auch den Paragrafen 218 kippen und Schwangerschaftsabbrüche insgesamt legalisieren.
In den 1970er Jahren hatten Frauenrechtlerinnen unter dem Slogan „Mein Bauch gehört mir“ für die Legalisierung von Abtreibungen gekämpft. Heute steht auf den Plakaten und T-Shirts auf der Zuschauertribüne des Bundestags „Mein Körper, meine Entscheidung – Weg mit § 219a“ oder „Abtreibung ist kein Verbrechen“. Auch wenn es nur wenige Demonstrantinnen sind, die das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung zusammengetrommelt hat – sie haben Einfluss.
Nachdem Ende 2017 eine Ärztin aus Gießen zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Internetseite für Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis geworben hatte, ist in Deutschland der Streit um das Abtreibungsrecht neu entflammt. Linke, Grüne und die FDP wollen den Paragraf 219a abschaffen oder zumindest reformieren.
Der Paragraf verbietet es, Schwangerschaftsabbrüche öffentlich anzukündigen oder anzupreisen. Eigentlich würde auch die SPD das Verbot gerne kippen. Doch um den ohnehin strapazierten Koalitionsfrieden mit der Union, die an der Regelung festhalten will, nicht weiter zu belasten, haben die Sozialdemokraten ihren Gesetzentwurf zurückgezogen.
Bei einer Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestags machte Katharina Jestaedt, stellvertretende Leiterin des katholischen Büros, unmissverständlich klar, dass für die Kirche der Schutz des Lebens über allem stehe. Die Juristin befürchtet, dass Abtreibungen im Falle einer Abschaffung des Paragrafen zu einer „gewöhnlichen Dienstleistung“ verkommen könnten. Das Gesetz wirke einer Bagatellisierung von Schwangerschaftsabbrüchen entgegen.
Der Augsburger Juraprofessor Michael Kubiciel geht in seiner Argumentation noch einen Schritt weiter. Er befürchtet eine Kommerzialisierung von Abtreibungen. Bereits vor der Anhörung hatte sich auch der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, für einen Fortbestand der seit 1933 geltenden Regelung starkgemacht.
Eine rechtswidrige Tat
Er sagt, es sei intuitiv nachvollziehbar, dass man für eine rechtswidrige Tat nicht werben darf. In seiner Argumentation verweist er auf das in Paragraf 218 geregelte Abtreibungsrecht, wonach Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Woche grundsätzlich rechtswidrig, aber unter bestimmten Voraussetzungen straffrei sind.