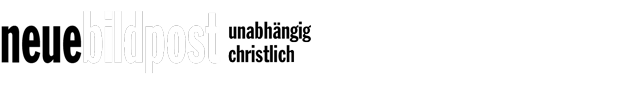In vielen Teilen Deutschlands hat sich die Corona-Situation deutlich gebessert. Gastronomie und Hotels dürfen langsam wieder öffnen. Kitas und Schulen betreuen wieder mehr Kinder. Andere Länder dagegen hat die Pandemie noch voll im Griff. Keine Weltregion bleibt von den Auswirkungen verschont. Und doch gibt es Stimmen, die Corona auch Positives abgewinnen: Sie sehen durch die Pandemie Solidarität und Nächstenliebe gestärkt.
Das betrifft nicht nur ältere Menschen in Pflegeheimen, die ganz unerwartet Post von lieben Mitmenschen bekommen, sondern auch Kinder, denen neue Spiele übers Internet vorgestellt werden, oder Vierbeiner, die sich auf einmal über ganz viele Gassi-Geher wundern. Wie sieht es auf anderen Kontinenten aus? Wie gehen dort die Menschen miteinander um, und wie hat die Notlage ihr Leben geprägt?
Stefan Hippler, Priester des Bistums Trier, lebt seit 1997 in Südafrika. Damals wurde er zunächst für die Zeit von zwölf Jahren in die deutschsprachige katholische Gemeinde in Kapstadt entsandt. Sein Traum war es, vor Ort bleiben zu können. Seit 2009 trägt der gebürtige Bitburger den Titel „resident priest“ (etwa: Priester mit Bleibestatus).
Zwischen Kontinenten
2001 gründete Hippler die Hilfsorganisation „Hope Cape Town Association“. Später kamen der „Hope Cape Town Trust“ als südafrikanische Stiftung hinzu, eine deutsche Stiftung und zuletzt ein gemeinnütziger Verein mit Sitz im texanischen Dallas. Damit schuf er eine Verbindung der Hilfe zwischen Südafrika, Deutschland und den USA. „Gerade in der Corona-Krise ist Solidarität zwischen Kontinenten sehr wertvoll“, sagt Hippler.
Man verstehe sich nicht so sehr als klassische Hilfsorganisation, sondern als Gruppe von Menschen, „die mit anderen ein Stück des Weges gehen, Leben teilen, voneinander lernen und ihre Fähigkeiten einbringen“, betont der katholische Pfarrer. „Bei einer sehr strengen Ausgangssperre sind die Menschen auf Hilfe angewiesen. Es gibt einfach nicht genug zu essen.“
Daher sorgt „Hope Cape Town“ täglich mit Hilfe von Freiwilligen dafür, dass Hunderte von Kindern Frühstück, ein warmes Mittagessen und Hygieneartikel erhalten. Darüber hinaus unterstützt die deutschsprachige katholische Gemeinde am Kap weitere Sozialprojekte.
Nicht erst jetzt erlebt Pfarrer Hippler gelebte Nächstenliebe: „Die Kinder der Deutschen Internationalen Schule ließen sich zur vergangenen Weihnachtsfeier Namen und Alter unserer betreuten Kinder geben und bastelten für jedes von ihnen eine Geschenkbox.“ Für Hippler sind es Aktionen wie diese, mit denen die Menschen Herz zeigen und Mut machen.
Auch Eder Pena aus Rio de Janeiro spricht von gelebter Solidarität. Der Ökonom arbeitet aktuell von zu Hause aus. Als Experte fürchtet er den wirtschaftlichen Zusammenbruch. Glaube spiele für ihn eine große Rolle, sagt er, doch bete er in diesen Zeiten nicht häufiger als sonst auch.
„Entscheidend für mich ist, wie ich mit Gott kommuniziere. Dabei kommt es auf die Qualität meiner Gespräche mit ihm an und nicht auf die Quantität.“ Pena ist davon überzeugt, dass die Menschen durch die Krise demütiger werden und auch mit weniger Konsum große Ziele erreichen können.
In Brasilien sind derzeit spezielle Spenden-Körbe weit verbreitet. Sie enthalten Grundnahrungsmittel wie Reis, Bohnen, Öl, Kaffee, Milch und Hygieneartikel. Abgegeben werden sie in Supermärkten, Polizeistationen oder in Kirchengemeinden zur weiteren Verteilung an Bedürftige.
Auch das Justizwesen hat sich im Zuge von Corona verändert. Richter verurteilen Kleinkriminelle zur Abgabe von Körben, statt ihnen eine Geldstrafe aufzubrummen. „Die Anzahl richtet sich nach dem Delikt, das begangen wurde“, sagt Pena. Und Nachbarschaftshilfe gibt es auch: „Wir bekamen Gesichtsmasken geschenkt, als diese knapp waren.“
In Franken „gestrandet“
Weil ihre Schwester starb, kam Claudia Dettelbacher im März zu Beginn der Corona-Krise nach Deutschland, ins unterfränkische Schweinfurt. Eigentlich lebt sie mit ihrer Familie in Guatemala. Aber wegen der Reisebeschränkungen ist sie nun erst einmal in Deutschland „gestrandet“. Es gibt keine Flüge mehr in ihre Wahlheimat.