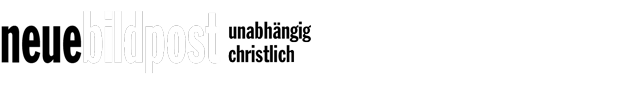WASHINGTON/BERLIN – „Jedes Kind ist ein Bild Gottes und wird von ihm geliebt“: So lautet die Botschaft der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland, die mit der am Samstag beginnenden „Woche für das Leben“ einhergeht (siehe kursiver Text unten).
Leider ist die Liebe der Menschen weniger allumfassend und gütig als die Liebe Gottes: Kinder mit dem Gendefekt Trisomie 21 werden heute in den meisten Fällen abgetrieben – also im Mutterleib getötet oder sogar künstlich zur Welt gebracht, damit sie anschließend sterben. Die moderne Pränataldiagnostik sorgt für immer subtilere Selektionsmethoden. Dagegen macht die Woche für das Leben mobil.
Bewegung in den USA
Nicht nur in Deutschland und Europa kämpfen die christlichen Lebensschutz-Gruppen dafür, dass Menschen mit Trisomie 21 zur Welt kommen dürfen. Auch in den USA, wo alljährlich allein in Washington Hunderttausende Menschen beim Marsch für das Leben auf die Straße gehen, wird das vorgeburtliche Töten nicht einfach so hingenommen. Wie man es vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten erwartet, ist dabei die Medienbeteiligung groß. Neben simplen Fakten spielen auch Gefühle eine wichtige Rolle, um die Menschen auf das Thema hinzuweisen.
Baby Lucas erweicht seit Wochen die Herzen der US-Amerikaner. Der Eineinhalbjährige mit dem grünen Hemdchen und der gepunkteten Fliege ist ein kleiner Medienstar. Ein Hersteller für Babynahrung hat ihn als „Gerber Spokesbaby 2018“ zum Hauptdarsteller einer Werbekampagne gemacht.
Das rührende Foto hat seine Mutter an die Firma geschickt, um zu zeigen, dass ihr mit Trisomie 21 zur Welt gekommenes Baby kein bedauernswertes Opfer des Schicksals ist. Obwohl das Down-Syndrom mit geistigen und körperlichen Einschränkungen einhergeht, genieße Lucas sein Leben. Der Junge leide nicht, sondern er lebe nur anders: Das ist die eindringliche Botschaft der Kampagne.
Sie hat eine neue Diskussion über die Frage entfacht, ob ein Leben mit Mongolismus, wie man den genetischen Defekt früher nannte, lebens- und schützenswert ist. Die Debatte ist ganz im Sinne von Karen Gaffney, die weltweit für das Lebensrecht von Föten eintritt, bei denen durch Pränataldiagnostik Trisomie 21 festgestellt wurde. Niemand kann das glaubwürdiger einfordern als sie. Die Frau aus Portland im US-Bundesstaat Oregon lebt selbst mit dem Gendefekt. Gaffney verändert genau wie Baby Lucas den Umgang der Gesellschaft mit den Betroffenen.
Sportlich und redebegabt
Mehrmals schwamm sie von San Francisco durch das eiskalte Meer zur ehemaligen Gefängnisinsel Alcatraz. 2001 schaffte sie als Mitglied einer Staffel sogar die Durchquerung des Ärmelkanals. Noch beeindruckender sind ihre Fähigkeiten als engagierte Rednerin. Erst im Januar zog sie die Zuhörer einer „One-Life“-Veranstaltung in Los Angeles durch ihren Vortrag in den Bann. „Ich möchte, dass meine Botschaft laut und deutlich ankommt“, rief sie den Anwesenden zu, die zu ihrem leidenschaftliches Plädoyer gegen Abtreibung aufstanden und begeistert applaudierten.
Die Organisatorin der Veranstaltung, Kathleen Domingo, ist wie viele andere in der Pro-Life-Bewegung tief beeindruckt von der redegewandten Gaffney, deren Chance, dass sie heute noch einmal geboren würde, von Jahr zu Jahr kleiner werde. Die Abtreibungsquote nach einer Trisomie-21-Diagnose bewegt sich in Europa bei 92 Prozent, in den Vereinigten Staaten entscheiden sich mehr als zwei von drei Frauen für einen Abbruch.
Vom Herz zum Hirn
Die Präsidentin des „March of Life“, Jeanne Mancini, spricht von „einer schockierenden Bilanz“. Umso willkommener ist nun die durch Baby Lucas ausgelöste Debatte. Sie habe die Kraft, Herzen zu bewegen, um über die Möglichkeiten nach einer Trisomie-21-Diagnose anders nachzudenken. Die Pro-Life-Bewegung hofft auf eine Umkehrung des Trends, der zu immer mehr Abtreibungen geführt hat.
Gaffney, die an einer katholischen High School den Abschluss schaffte, trägt ihren Teil dazu bei. Sie hält Reden gegen die Ängste betroffener Eltern: „Ich sage Ihnen, es gibt ein Leben für Menschen wie mich.“
Befürworter liberaler Abtreibungsregeln widersprechen und verweisen auf die ihrer Meinung nach unzulässige Gegenüberstellung von Behindertenrechten mit der Entscheidungsfreiheit der Frau. Nach Angaben des Guttmacher-Forschungsinstituts, das mit der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeitet und pro Abtreibung eingestellt ist, gelten in mehreren US-Bundesstaaten Gesetze, die den Zugang zu Abtreibungen bei Fehlentwicklungen des Fötus einschränken.
Gaffney und Baby Lucas rücken die Rechte ihrer Schicksalsgenossen ins Zentrum der öffentlichen Diskussion. „Sie ist eine junge Frau, die sich nicht dauernd sagen lassen will, was sie nicht kann“, sagte der Rektor der University of Portland in Oregon, Tom Greene, als er Gaffney 2013 die Ehrendoktor-Würde verlieh. Weltweit war es die erste Auszeichnung dieser Art für einen Menschen mit Down-Syndrom. Gaffneys Botschaft an die „normalen“ Menschen im Publikum brachte ihr Anliegen damals auf den Punkt: „Ich möchte allen ohne Down-Syndrom zu verstehen geben, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als uns trennt.“
Bernd Tenhage
Unter dem Motto „Kinderwunsch. Wunschkind. Unser Kind!“ setzt sich die „Woche für das Leben“ der katholischen und der evangelischen Kirche in diesem Jahr mit der Pränataldiagnostik auseinander. Die seit 1994 bestehende ökumenische Aktion findet vom 14. bis 21. April statt.
Am zentralen Eröffnungsgottesdienst am 14. April im Trierer Dom nehmen der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der Trierer Bischof Stephan Ackermann sowie der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, teil.
Bei der Aktionswoche geht es um Aspekte der besseren medizinischen Versorgung für Mutter und Kind, aber auch um die aus Kirchensicht sehr bedenkliche Seite der Pränataldiagnostik. Die Untersuchungen an Föten und schwangeren Frauen zur Früherkennung von Krankheiten könnten Eltern und Ärzten die Gelegenheit eröffnen, sich optimal auf die Geburt des Neugeborenen und eine mögliche Operation im Fall einer Fehlbildung einzustellen, heißt es im Geleitwort von Bedford-Strohm und Marx. Doch die diagnostischen Möglichkeiten hätten eine Kehrseite. So könnten „Frauen und Paare gerade zu Beginn einer Schwangerschaft einem inneren oder auch äußeren Druck ausgesetzt“ sein.
Müttern und Vätern begegne zuweilen eine gesellschaftliche Mentalität, „die das neugeborene Leben nach anderen Kriterien bemisst. Etwa wenn es heißt, dass ein mit Krankheit oder Behinderung geborenes Kind ‚heute nicht mehr nötig‘ sei.“
Bedford-Strohm und Marx betonten im Vorfeld: „Jedem Kind kommt die gleiche Würde zu, unabhängig von allen Diagnosen und Prognosen. Jedes Kind ist ein Bild Gottes und wird von ihm geliebt.“ Die Bewertung pränataldiagnostischer Methoden sei nicht nur eine medizinisch-technische Angelegenheit. „Auch ethische Kriterien, psychosoziale Dynamiken und die jeweiligen gesellschaftlichen Auswirkungen müssen berücksichtigt werden“, fordern Marx und Bedford-Strohm.
KNA