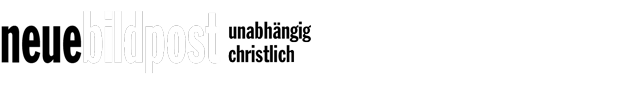Die Bluttat ist bis heute nicht vergessen, ihre Folgen sind noch immer gegenwärtig: 29 Tote, mehr als 150 Verletzte – so lautet die Schreckensbilanz jenes Februartages 1994 im palästinensischen Hebron. Ein Blick in die Stadt im besetzten Westjordanland 25 Jahre nach dem Massaker eines rechtsextremen Juden an wehrlosen betenden Palästinensern.
Eine geteilte Straße – die eine Seite für palästinensischen Verkehr, die andere für jüdischen. Hunderte per Militärdekret zwangsgeschlossene Geschäfte. Mehr als 100 Hindernisse und Sperren der israelischen Armee. Und die Märtyrer-Straße, eine sogenannte „sterile“ Straße – gänzlich für palästinensische Fußgänger, Fahrrad- oder Autofahrer gesperrt. Es sind nur vier Facetten der Einschränkungen, denen die Palästinenser in Hebron ausgesetzt sind.
Jene Tat, die sich an diesem Montag zum 25. Mal jährt, hat zum einen den Selbstmordterror der palästinensischen Hamas ausgelöst, zum anderen zu den Maßnahmen der israelischen Armee geführt: Am 25. Februar 1994 erschoss der jüdische Militärarzt und radikale Siedler Baruch Goldstein 29 muslimische Palästinenser beim Ramadan-Morgengebet in den Patriarchengräbern der Ibrahimi-Moschee. Mehr als 150 Gläubige wurden verletzt.
Nachdem seine Munition aufgebraucht war, wurde Goldstein von überlebenden Palästinensern mit einem Feuerlöscher erschlagen. In den Tagen nach dem „Massaker“, wie die Palästinenser die Tat nennen, wurden bei Ausschreitungen weitere 25 Palästinenser getötet. Auch fünf israelische Juden kamen ums Leben. Wochenlang mussten Palästinenser in Hebron fortan unter der Ausgangssperre des israelischen Militärs leben.
Attentäter Goldstein wurde an seinem Wohnort, in der benachbarten jüdischen Siedlung und Extremistenhochburg Kirjat Arba, zur letzten Ruhe gebettet. Auf seinem Grabstein wird er nach wie vor als „Heiliger“ und „Märtyrer“ gepriesen. Nationalreligiösen und ultrarechten Juden gilt der Mörder als Held. Sein Grab hat sich zu einem regelrechten Wallfahrtsort für die Siedlerbewegung entwickelt.
Drei Wochen nach dem Attentat rief der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in seiner Resolution 904 zum Schutz für die palästinensische Zivilbevölkerung auf. Eine internationale Präsenz sollte sie sicherstellen. Die im Mai 1994 eingesetzte erste Beobachtermission wurde jedoch nach nur drei Monaten beendet.
Internationale Präsenz
Im Rahmen des Oslo-Friedensprozesses vereinbarten Israel und die Palästinensische Befreiungsbewegung PLO drei Jahre später, erneut eine vorübergehende internationale Präsenz einzurichten. Diese „Temporary International Presence in the City of Hebron“ – kurz: TIPH – sollte durch Beobachtung und Berichterstattung „ein normales Leben und ein Sicherheitsgefühl der Palästinenser“ fördern.
Man einigte sich auf einen Teilabzug des israelischen Militärs und teilte die alte Handelsstadt in zwei Sektoren auf: Die palästinensische H1-Zone umfasst 80 Prozent der Stadt. Die restlichen 20 Prozent, H2, unterstehen israelischer Kontrolle. Dort, in der Altstadt, leben etwa 40 000 Menschen. Die Zone umfasst die Christen, Muslimen wie Juden gleichermaßen heilige Machpela-Höhle, wo die Gräber von Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka, Jakob, Lea und Esau verehrt werden – jene Patriarchengräber, an denen Baruch Goldstein 29 Menschen den Tod brachte.