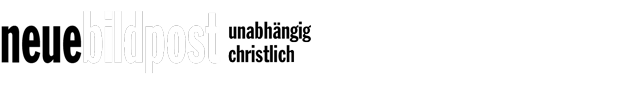Es ist der 18. August 1976. Vor der Michaeliskirche im sachsen-anhaltinischen Zeitz übergießt sich ein Mann mit Benzin und zündet sich an. Pastor Oskar Brüsewitz hat sich zu der Verzweiflungstat entschlossen, um gegen die „Unterdrückung von Kindern und Jugendlichen“ an den Schulen der DDR zu protestieren.
Vier Tage nach seiner Tat stirbt Oskar Brüsewitz, der 1954 aus Hildesheim in die DDR übergesiedelt ist, in einer Hallenser Klinik. Dem Arzt soll er noch zugeflüstert haben, dass seine Aktion „gegen den Kommunismus gerichtet“ gewesen sei. Das blieb nicht ohne Folgen: Wenige Tage später berichtet auch die ARD ausführlich über die Geschehnisse in der ostdeutschen Provinz.
Erich Honecker erklärte den Vorfall in Zeitz kurzerhand zur „Chefsache“. Ein Pastor, der sich öffentlich das Leben nahm und dafür politische Motive ins Feld führte? Unmöglich im angeblichen Paradies der Arbeiter- und Bauernmacht! Die SED fühlte sich ertappt und fürchtete, dass von der spektakulären Selbsttötung eine Signalwirkung für weitere Proteste ausgehen würde.
An Brüsewitz‘ Beerdigung nahmen knapp 370 Trauergäste teil, darunter ausländische Journalisten.Rippicha, wo Brüsewitz zur letzten Ruhe gebettet wurde, glich einer Festung und war abgeriegelt von Kräften der Staatssicherheit, die in buchstäblich überall saßen, um mögliche Aktionen vor Westkameras schon im Keim zu ersticken, was zeigte, wie ernst die Partei die Sache nahm.
Zu Reaktionen in der Bevölkerung kam es erst, als am 31. August 1976 im SED-Parteiorgan „Neues Deutschland“ ein diffamierender Beitrag über Oskar Brüsewitz erschien, den zahlreiche Leser mit kritischen Leserbriefen und sogar einer Strafanzeige wegen Verleumdung quittierten. Die SED war überrascht über so viel Protest im eigenen Land und reagierte mit gewohnter Härte, auch Haftstrafen gegen ihre Kritiker.
An Brüsewitz scheiden sich bis heute die Geister. Für die einen ist er ein Held im Kampf gegen die SED-Diktatur, für die anderen ein einsamer Landpfarrer, dessen Selbstverbrennung nur Ausdruck seiner „labilen Psyche“ gewesen sei. Jahrelang hatte Brüsewitz Parteibonzen mit provokanten Aktionen gepiesackt. Unvergessen ist das leuchtende Neonkreuz, das er auf die Rippichaer Dorfkirche montierte und das quasi das Licht des Glaubens im atheistischen Umfeld symbolierte.
Mutiger Einzelgänger
Das Kreuz befindet sich heute im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig und ist in den vergangenen Jahren so etwas wie eine politische Reliquie der frühen DDR-Opposition geworden – wohl auch deshalb, weil immer mehr Historiker und Publizisten Oskar Brüsewitz als einen geistigen Vater der friedlichen Revolution von 1989 entdecken: ein mutiger Einzelgänger, der der roten Diktatur lange vor Michail Gorbatschows Reformen die Kante zeigte.
„Brüsewitz hatte keine Freunde und war in seiner Kirche isoliert“, will dagegen Karsten Krampitz herausgefunden haben, dessen Dissertation über den oppositionellen Pfarrer kürzlich im linksgerichteten Berliner Verbrecher-Verlag erschienen ist. In seiner Arbeit greift Krampitz ausgerechnet Informationen und Gerüchte auf, die das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in den 1960er Jahren über Brüsewitz sammeln und wohl auch heimlich verbreiten ließ.
Brüsewitz würde gerne leicht bekleidet mit Kindern herumtollen und damit den Argwohn seiner Gemeinde erwecken, hieß es sinngemäß in diversen MfS-Dossiers, die sich später auch das „Neue Deutschland“ zu eigen machte. Gerüchte wie diese halfen der Staatssicherheit, immer neue Informanten zu rekrutieren, die sich berufen fühlten, Brüsewitz in Misskredit zu bringen.
„Wir ahnten, dass wir von Zuträgern umgeben waren“, erinnerte sich Brüsewitz‘ Witwe Christa in einem Gespräch im Sommer 2006. Ihr Mann habe die Lebensumstände der Familie gelassen als „Gottes Wille“ hingenommen. Als Christa Brüsewitz erstmals in den Stasi-Akten der damaligen Gauck-Behörde blätterte, habe sie an vielen Stellen herzhaft lachen müssen – so absurd waren die Vorwürfe, die das MfS sauber auflistete.
Bezeichnenderweise hat es Karsten Krampitz vermieden, Christa Brüsewitz oder Tochter Esther als Zeitzeugen für seine Dissertation zu befragen. Nach solchen Gesprächen wäre vermutlich manche seiner Thesen in sich zusammengefallen. Auch dass Brüsewitz ein leidenschaftlicher Familienmensch war, wird bei Krampitz mit keinem Wort erwähnt.
Linientreuer Dozent
In Teilen liest sich die Dissertation so, als wolle da jemand auf subtile Weise die unvollendete Arbeit der Staatssicherheit vollenden. Seine Begründung mag das in Krampitz‘ Werdegang finden: Der Autor, Jahrgang 1969, ist seit Jahren bei der Linken aktiv, als politischer Aktionskünstler und Mitarbeiter der linken Zeitung „Junge Welt“. Krampitz‘ Doktorvater ist Gerd Dietrich, einst linientreuer Dozent am Ost-Berliner Institut für Marxismus-Leninismus.
Brüsewitz‘ Tod fiel in eine Zeit, die Historiker heute als „Krisenjahr“ der DDR bezeichnen, als Anfang vom Ende. Nach außen hin schien sich die SED-Diktatur gefestigt zu haben. Immer mehr Haushalte verfügten über Autos, Waschmaschinen und Farbfernseher. Dennoch ging das Rezept, politische Unfreiheit mit sozialer Sicherheit zu erkaufen, nicht auf: Das Volk hatte sich an billige, weil subventionierte Mieten und Brotpreise gewöhnt und kehrte der Obrigkeit dennoch den Rücken.
Die Krise spitzte sich zu, als die DDR den kritischen Liedermacher Wolf Biermann nach einem Konzert in Köln nicht mehr einreisen ließ. Auch andere namhafte Künstler verließen das Land. Brüsewitz‘ Selbstverbrennung sehen Historiker daher auch vor dem Hintergrund einer sich innenpolitisch zuspitzenden Lage.
„Mit der Biermann-Ausbürgerung hatten wir uns selbst demontiert“, räumte nach der Wende SED-
Politbüromitglied Günter Schabowski ein. Endgültig war klar geworden, dass die Partei ihren Gegnern nur mehr gewaltsam begegnen wollte, was den Weg in den Revolutionsherbst 1989 weiter ebnete.
Benedikt Vallendar