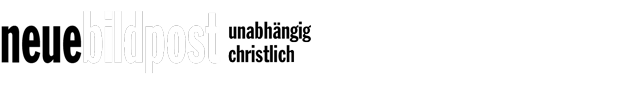Kaum eine Jahreszeit ist so schokoladig wie der Advent mit all seinen Schoko-Nikoläusen und dem Christbaumschmuck aus der süßen braunen Masse. „Schokolade macht glücklich“ ist eine bekannte Aussage. Sie gilt als Kraftspenderin und Nervennahrung. Einbildung ist das keineswegs – doch es kommt auf die Qualität an. Für viele Menschen muss es Schweizer Schokolade sein. Eine Spurensuche.
Deutschland und die Schweiz verbindet die Vorliebe für Schokolade. Die Deutschen essen durchschnittlich neun Kilo pro Kopf und Jahr. Die Schweizer brachten es 2021 sogar auf mehr als elf Kilo. Ob Schokolade gut oder weniger gut für die Gesundheit ist, hängt von der Kakaomenge ab. Je mehr Kakao und weniger Zucker, desto gesünder ist sie.
Interesse findet es neuerdings auch, heißen naturbelassenen und ungezuckerten Kakao zu trinken – wie einst die Azteken. Nach bisherigen Darstellungen sollen sie in Mexiko die ersten gewesen sein, die aus zerkleinerten Kakaobohnen und Wasser einen Trank herstellten und als Speise der Götter bezeichneten. Vom 14. bis zum frühen 16. Jahrhundert muss das gewesen sein. „Xocolatl“ könnte der Trank geheißen haben.
Gemäß einer Legende soll Quetzalcoatl, der Gott des Windes, den Azteken die Kakaopflanze gebracht haben. Der daraus später kreierte bittere Trank galt als Stärkungs- und Heilmittel und prägte die religiösen Feste. Darüber hinaus dienten die Kakaobohnen als Zahlungsmittel. Ein Hase kostete zehn Kakaobohnen, ein Sklave 100. Das deutsche Wort Schokolade leitet sich von dem historischen aztekischen Ausdruck ab.
Die Nutzung von Kakao indes reicht viel weiter zurück. Schon die Olmeken in Mittelamerika sollen den ursprünglichen bitteren Kakao getrunken haben: 1500 vor Christus nämlich. Die neuesten Entdeckungen lieferte 2018 eine Forschergruppe der Universität Calgary in Kanada. Sie fand an der archäologischen Stätte Santa Ana/La Florida im Süden von Ecuador 5300 Jahre alte Rückstände von Kakaobohnen.
Nach Europa gelangte die Bohne nach der Eroberung Mexikos durch die Spanier unter Hernán Cortés. Ab 1519 besiegte er in einem zweijährigen Feldzug die Azteken. Bei seiner Rückkehr nach Spanien nahm Cortés auch Kakaobohnen mit an Bord. Der daraus gefertigte Trunk war seinen Landsleuten zu bitter. Erst als sie Zucker hinzufügten, wurde er ein begehrtes Getränk. Weil Zucker teuer war, konnten sich das aber nur Könige, der Adel und Reiche leisten.
In der Fastenzeit erlaubt?
Die Kirche, die ihren Gläubigen das Kakaotrinken wegen der angeblich aphrodisierenden Wirkung zunächst verboten hatte, lenkte bald ein. Stattdessen musste sie sich mit der Frage befassen, ob dieser Trank auch in der Fastenzeit erlaubt sei. Die Jesuiten meinten ja, die Dominikaner sagten nein und bezeichneten das Getränk als Mahlzeit. Vier Päpste nacheinander mussten sich mit der Frage befassen. Das Ergebnis: Kakao ist ein Getränk und daher auch in der Fastenzeit erlaubt.
Königin Marie Antoinette von Frankreich bestellte sich übrigens einen heißen Kakao, bevor sie am 16. Oktober 1793 durch die Guillotine enthauptet wurde. Heute geht es beim Kakao selten um Leben und Tod. Aber doch immerhin um den Lebensunterhalt: den der Bauern nämlich, die die Bohnen in Mittel- und Südamerika, in Afrika oder Südostasien anbauen. Wie kann man sie unterstützen und fair bezahlen?