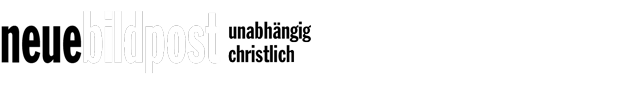Der Südsudan gilt heute als „gescheiterter Staat“. Nach der vor zehn Jahren, im Juli 2011, erlangten Unabhängigkeit vom islamistischen Norden führten die Volksstämme fünf Jahre lang Bürgerkrieg. Auch nach dem Friedensschluss kommt das Land nicht zur Ruhe, erzählt Pater Gregor Schmidt. Der Comboni-Missionar aus Deutschland betreut als Seelsorger den Stamm der Nuer im Schwemmgebiet des Nils. Er berichtet über Land, Leute und – Lieder, ein Kernelement seiner Seelsorge.
Pater Gregor, nachdem der Bürgerkrieg seit Herbst 2018 offiziell zu Ende ist: Wie stabil ist derzeit der Frieden im Südsudan?
Ich würde so sagen: Der Patient hat immer ein bisschen Fieber. Mal ist es eine etwas höhere Temperatur, mal eine etwas niedrigere. Das Land ist nicht wirklich zum Frieden gekommen. Es ist nur eine Art Atempause. Die Übergangsregierung hätte stabile politische Verhältnisse herbeiführen können. Aber nach dem, was Beobachter sagen, waren die vergangenen zweieinhalb Jahre vertane Zeit. Die Machthaber haben politisch zu wenig vorangebracht, um dem Land durch die Administration Stabilität zu geben oder Wahlen vorzubereiten. Deswegen kann die momentane Pause auch wieder in einen offenen Bürgerkrieg münden.
Zwar herrscht zwischen Dinka und Nuer, den beiden Hauptparteien des Bürgerkriegs, relative Ruhe. Das liegt vor allem am enormen Druck der internationalen Gemeinschaft und der Nachbarländer.
Für das Jahr 2020 jedoch berichtet Yasmin Sooka, die Vorsitzende der UN-Kommission für Menschenrechte im Südsudan, dass die Gewalt im Land erheblich zugenommen hat. Ob das aber dem Bürgerkrieg zugerechnet werden muss oder der durch Gesetzlosigkeit gewachsenen Bandenkriminalität, ist nicht klar.
Tragen finanzielle Hilfen aus dem Ausland zu einer Verbesserung der Lage bei?
Die internationale Gemeinschaft pumpt Hunderte Millionen von Dollars in den Südsudan. Das ist aber wie ein „Betäubungsmittel“ für die politische Elite. Sie ist korrupt und wird praktisch mit internationalen Geldern „gefüttert“, die sie für sich abzweigt. Sichtbar wird das in der Hauptstadt Juba, wo es viele Autohändler gibt, die Luxusautos und SUVs an bestimmte Leute verkaufen, die sich bereichert haben.
Für die internationale Gemeinschaft, die diesen Friedensprozess begleiten möchte, ist das ein totales Fiasko. Denn der Regierung wird nicht geholfen, selbstständig das Land zu führen. Sie benimmt sich, als sei sie im Schlaraffenland. Wenn dann mal die internationale Gemeinschaft den Geldhahn zudrehen würde, könnte das wieder im Bürgerkrieg enden. Weil die Leute merken, dass es nichts mehr zu verteilen gibt.
Wenn eine ausländische Organisation im Land tätig sein will, muss sie den Dollar bei der Zentralbank gegen lokale Währung umtauschen. Sie bekommt diese für einen schlechten Umtauschkurs von teilweise nur einem Viertel des ursprünglichen Wertes. Bis zu drei Viertel von jedem Dollar, der ins Land kommt, schöpft die politische Elite ab, bevor das Geld im Land überhaupt für Projekte verwendet werden kann.
Zum Beispiel hat die Europäische Union ein Programm gestartet, mit dem Lehrergehälter bezahlt werden sollen: Jeder Grundschullehrer im Land soll von der EU pro Monat für seine Arbeit 40 Dollar bekommen. Das ist zwar wenig, aber es wäre gar nicht so schlecht. Doch die Geldgeber dürfen das nicht in Dollar auszahlen. Sondern sie müssen das Geld bei der Zentralbank umtauschen. Der Lehrer bekommt dann, wenn für ihn überhaupt etwas bleibt, umgerechnet etwa zwölf Dollar.
So verstärken Hilfsgeld-Aktionen nur die Passivität und die Korruption. Der Jahresbericht von Transparency International nennt für 2020 den Südsudan das korrupteste Land der Welt – neben Somalia.
Der Südsudan ist nicht von Corona verschont geblieben. Welche Auswirkungen hatte die Pandemie bisher?
Ich lebe sehr entlegen im Sumpfgebiet des Nil, 600 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Da wird nicht getestet, da werden keine Schutzmaßnahmen vorgegeben. Wir leben so wie immer. Das Virus, für die Menschen eine unsichtbare Krankheit, ist nicht aufgefallen, weil ein Großteil der Landbevölkerung keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hat.
Man muss sich das so vorstellen wie vor Einführung der modernen Medizin in Europa im 19. Jahrhundert. Da ist die hohe Sterberate unter anderem bedingt durch ganz gewöhnliche Krankheiten: Impfungen, zum Beispiel für Tetanus oder Polio, gibt es kaum. Viele Leute sterben jung.
Die Altersgruppe derjenigen, von denen anderswo viele an Corona sterben, also die über 60- oder 70-Jährigen, gibt es bei uns fast nicht. Das Durchschnittsalter liegt bei 15 Jahren, die durchschnittliche Lebenserwartung bei 56 Jahren. Was man in Deutschland die Risikogruppe nennt, existiert im Südsudan – zumindest auf dem Land – nicht. Von daher ist Corona in dieser Region kein Thema.
Ein bisschen anders ist es in der Hauptstadt, weil da die Administration ja auch ein wenig Kontrolle über das Stadtleben hat. Da wird geringfügig getestet. Seit Beginn der Corona-Krise hat man im Südsudan etwa 10 000 Personen positiv getestet. Davon sind 117 gestorben, also etwa ein Prozent der positiv Getesteten. Die tatsächlichen Infektions- und Todeszahlen werden höher sein. Es ist aber wenig Genaues über den Verlauf der Infektionen bekannt. Insgesamt gibt es für die Südsudanesen Probleme, die weitaus belastender sind als die Pandemie.
Berichte über die Not im Südsudan gehen von 8,3 Millionen Menschen aus, die in diesem Jahr auf humanitäre Hilfe angewiesen sind: rund zwei Drittel der Bevölkerung. Das ist ein Höchststand seit der Unabhängigkeit. Nehmen der Hunger, das Leid der Menschen zu?
In der Region des Nil, in der ich lebe, hat der Fluss seit Mitte 2020 Hochwasser, weil in Uganda riesige Wassermengen aus dem Viktoria-See abgelassen worden sind. (Anm. d. Red.: Nach sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen in Ostafrika stieg der Wasserstand des Sees zuvor auf ein Rekordhoch.) Hochwasser haben wir sonst jedes Jahr. Aber dieses Jahr ist es noch einen Meter höher. Und das bedeutet, dass die meisten Dörfer überschwemmt werden. Es sei denn, man baut Deiche.
Es gibt viele Geisterdörfer, die verlassen wurden. Dort, wo die Menschen bleiben, müssen sie einen Ring um ihren Hof bauen, um sich zu schützen. Sie leben dann in einem riesigen See, weil die ganze Umgebung überschwemmt ist. Oder eine Dorfgemeinschaft muss ihr ganzes Gebiet umfrieden. Da müssen dann alle mit anpacken.
Ich war im Dezember, wenn normalerweise die Trockenzeit beginnt, auf einer Reise zu den Kapellen. Früher bin ich gewandert, nun aber, weil die Wege alle überflutet sind, mit dem Kanu gefahren. Ich habe bei einer Familie übernachtet und miterlebt, dass der Deich über Nacht brach. Wir mussten mit Eimern mehrere tausend Liter Wasser schöpfen, um das Grundstück zu retten.
In der ganzen Region wurde letztes Jahr nicht geerntet, weil das Flusswasser die Ernte zerstört hat. Dieses Jahr kann nicht gesät werden, weil der Wasserstand nur wenig gesunken ist. Dadurch haben wir das zweite Jahr in Folge einen Ernteausfall. Von daher ist es sehr ernst.