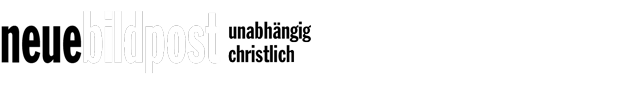Im Interview mit der katholischen Zeitung „Die Tagespost“ äußert sich der Augsburger Bischof und Weltkirchebischof Bertram Meier nachdenklich zum Verlauf des Ad-Limina-Besuchs in Rom. Er betont die Dringlichkeit der Missbrauchs-Aufarbeitung, hebt jedoch zugleich die Bedeutung der Evangelisierung für die Zukunft der Kirche hervor. Ob das neue kirchliche Arbeitsrecht das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter stärkt? Das liegt laut Bischof Meier an der Kirche selbst, indem sie dies fördert.
Herr Bischof, der Ad-Iimina-Besuch liegt eine Woche zurück. Was beschäftigt Sie jetzt, nachdem sich alles setzen konnte, noch besonders?
Mich bewegt die Erfahrung, dass wir zwar Gespräche führten, aber auch Kommunikationsprobleme hatten. Das betrifft nicht nur die sprachliche Ebene, sondern auch die Kultur des Dialogs. Wir haben viel mit Übersetzern gearbeitet, das schränkt den unmittelbaren Dialog bereits erheblich ein. Denn jede Übersetzung ist Interpretation. Doch neben der Linguistik spürte ich auch, dass wir verschiedenen „Sprachspielen“ folgten. Vielleicht stecken auch Mentalitätsunterschiede dahinter. Wir Deutsche treten gern systematisch und kraftvoll auf, was bei „den Römern“ mitunter so interpretiert wird, dass wir alles besser wüssten und als „Klassenprimus“ in der Weltkirche das Sagen haben wollen. Synodale Kirche schließt für mich eine Kultur des Anhörens und Zuhörens ein. Hören ist wechselseitig. Daher stelle ich mir die Gewissensfrage: Sind wir Bischöfe tatsächlich nach Rom gereist, um selbst zu hören, was die Römer uns zu sagen haben, oder wollten wir uns von unserer Warte aus im Vatikan mehr Gehör verschaffen und zeigen, wo es weltkirchlich langgehen soll?
Der Papst hat nochmal auf den Brief von 2019 verwiesen. Wie wollen die deutschen Bischöfe sich jetzt mit den Inhalten auseinandersetzen bzw. die päpstlichen Vorgaben konkret in den Prozess aufnehmen?
Es muss uns darum gehen, den Brief des Papstes, den er eigenen Angaben zufolge selbst verfasst hat, aus dem Eck der Vergessenheit herauszuholen. Ich wage die Behauptung: Wir haben den Papstbrief nicht gänzlich ignoriert, aber in seiner Bedeutung vernachlässigt. Zwar wurde bei der Audienz dem Papst versichert, dass sein Brief 80.000 Mal gedruckt worden sei, doch damit wollte sich der Heilige Vater zu Recht nicht zufriedengeben. Sinngemäß sagte er, dass sein Schreiben nicht in der Schublade verschwinden, sondern uns als Bezugspunkt für unseren Synodalen Weg dienen sollte. Mit meinen Worten gesagt: Der Papstbrief sollte unser Kompass sein, um das eigentliche Ziel des Synodalen Weges zu erreichen, die geistliche Erneuerung der Kirche, was strukturelle Veränderungen nicht ausschließt. Dies entspricht dem inkarnatorischen Prinzip: Das Wort ist Fleisch geworden; wenn uns der Heilige Geist durchdringt, wirkt sich das auch auf Strukturen aus.
Ein großes Thema dieses Briefes war auch die Evangelisierung. Wie soll es auf dem Synodalen Weg integriert werden — jetzt, wo die Synodalversammlung ja nur noch einmal tagt?
Das Projekt des Synodalen Weges wurde als Reaktion auf den Missbrauchsskandal aufgesetzt, der bis heute die Bischöfe schockiert. Dieser Schmerz muss sein. Der Missbrauchsskandal ist mehr als eine Tragödie, er ist eine Geschichte von Schuld und Sünde. Das dürfen wir nicht verharmlosen. Doch bei aller Aufarbeitung, Prävention und Transparenz sollten wir nicht vergessen, den Menschen das Evangelium anzubieten. Aufarbeitung des Missbrauchs und Verkündigung des Evangeliums schließen sich nicht aus, sie sind wie zwei Seiten einer einzigen Medaille, deren Prägung so aussieht: trotz der Schuld, die uns tief in den Knochen sitzt, die Kirche als Leib Christi so stabilisieren, dass sie Jesus Christus und seinem Evangelium dient. Kurz: Die Evangelisierung ist ein Dauerauftrag der Kirche, der weit über die letzte Vollversammlung des Synodalen Wege hinausgeht. Dass dieser Weg dornenreich und mühsam ist, versteht sich, nachdem so viel kostbares Porzellan der Glaubwürdigkeit zerbrochen wurde.
Insgesamt hat Rom grundsätzliche Bedenken in Bezug auf die Forderungen des Synodalen Weges angemeldet. Es werde keine Zugeständnisse geben in den großen Fragen wie Frauenpriestertum, Sexualmoral, christliche Anthropologie. Römische Interventionen sollen umgesetzt werden. Das ZdK hat sich dazu bereits geäußert und will dennoch weitermachen. Wie wollen die Bischöfe jetzt vorgehen – angesichts dessen, dass im Fall des Nichtgehorsams Rom gegenüber ein Moratorium drohen könnte?
Wir werden das Gespräch suchen – untereinander in der Bischofskonferenz und mit Rom. Ich selbst habe beim Ad-limina-Besuch die Erfahrung gemacht, dass ich durch die Kontakte und die gemeinsamen Mahlzeiten auch einzelne Mitbrüder intensiver gehört habe und in ihren Argumenten besser verstehen lernte. Mein Wunsch wäre, dass wir den Synodalen Weg im März 2023 anständig zu Ende bringen, was bedeutet: durchaus an den Texten weiterarbeiten und die Themen in Rom setzen, dann aber das Tempo herausnehmen und mit der Umsetzung warten, bis die Weltsynoden 2023 und 2024 getagt haben. Ich bin kein Prophet, aber ich wage die Behauptung: Manche Idee, die in Deutschland geboren wurde, wird in der Weltsynode präsentiert, aber auch relativiert. Realismus ist angesagt: Wenn wir mit Rom weiter gehen wollen, können wir derzeit nicht alles in Deutschland umsetzen, was der Synodale Weg mehrheitlich anrät. Partizipation heißt ja auch, mit einem Teil zufrieden zu sein und nicht die Hundertprozentlösung anzustreben. Ich für meinen Teil setze auf Geduld, Dialog und Demut.
Sehen Sie die Gefahr eines offiziellen Schismas und — wenn ja — wie wollen sie dieses verhindern?
Ich bemühe mich im Bistum, „den Laden zusammenzuhalten“. Dabei ist mir ein Rat des Ignatius von Loyola wichtig: Versucht, die Meinung des anderen zu „retten“. Einander den katholischen Glauben abzusprechen, hilft wenig. Es polarisiert. Aber die Klarstellung, dass es römische Leitplanken gibt, die Grenzen setzen, darf nicht fehlen. Deshalb bin ich für die Klarstellungen sehr dankbar, die wir Bischöfe in Rom gehört haben. Wir dürfen nicht alles, was wir meinen zu können. Bei meiner Bischofsweihe habe ich versprochen, „das von den Aposteln überlieferte Glaubensgut, das immer und überall in der Kirche unversehrt bewahrt wurde, rein und unverkürzt weiterzugeben.“ Außerdem habe ich versprochen, „dem Nachfolger des Apostels Petrus treuen Gehorsam zu erweisen.“ Diese
Versprechen sollen keine vorlauten Versprecher sein, die ich in Freude über meine Bischofsernennung ohne große Überlegung abgelegt habe. Die Versprechen sind für mich Verpflichtung. Ich fühle mich an sie gebunden.
Meinen Sie, dass jetzt Friede in die deutsche Debatte kommen kann? Wenn nicht, was kann jeder auf seine Weise tun?
„Ad limina“ ist vorbei. Der Vorhang ist gefallen. Aber das Stück geht weiter. Wir sehen es ja jetzt schon, dass die Diskussionen munter fortgesetzt werden. Ich für meinen Teil versuche, den Ball flach zu halten, aber mit Ruhe und Gelassenheit im Spiel zu bleiben. Es geht darum, eine geistliche Erneuerung der katholischen Kirche voranzutreiben, ohne sich vom Sog derer mitreißen zu lassen, die Druck machen. Ein Kriterium für eine geistliche Erneuerung besteht darin, nach dem Wachstum zu fragen: Dient die Reform dem Wachstum des Leibes Christi, der Vertiefung des Glaubens?
Auf dem Synodalen Weg geht es viel um Macht. Was ist Macht in den Augen Jesu?
Da kann ich nur mit Mk 10,42f. antworten, wo es um Machtmissbrauch geht: „Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ So sehe ich mein Amt als Priester und Bischof: Ich möchte den Menschen dienen, die mir anvertraut sind. Ich biete ihnen das Evangelium an, trichtere es ihnen aber nicht ein.
Die DBK hat gerade das neue Arbeitsrecht auf den Weg gebracht. Welche Konsequenzen hat das Arbeitsrecht für die Sexualmoral in der Kirche und die Nachfolge Jesu? Müssen die Mitarbeiter jetzt vor allem gute Arbeitnehmer sein und weniger Jünger Christi und Zeugen Jesu? Durch das neue Arbeitsrecht ist die Botschaft des Evangeliums von der Glaubwürdigkeit des Zeugen durch dessen Lebensform abgetrennt…
Dass rechtliche Kategorien nur bedingt geeignet sind, Moral durchzudrücken, ist unbestritten. Recht ist kein Druckmittel für Moral. Gleichzeitig zeigt sich in der neuen Grundordnung, dass weltliche Maßstäbe in den kirchlichen Raum eingedrungen sind. Hier liegt meines Erachtens der Knackpunkt: Das neue kirchliche Arbeitsrecht ist nicht nur ein „rein weltlich Ding“. Es birgt auch doktrinelle Implikationen. Die Herausforderung liegt darin, die Zeugenschaft, die von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erwarten ist, zu fördern. Wenn wir jetzt Hymnen auf eine „Kirche ohne Angst“ anstimmen, sollten wir nicht vergessen, dass „der Anfang der Weisheit die Gottesfurcht“ ist. Ich wünsche mir, dass das neue Arbeitsrecht nicht zu einer weiteren Selbstsäkularisierung der Kirche führt. In diesem Zusammenhang erinnere ich an ein Wort, das Papst Benedikt XVI. bei seinem Deutschlandbesuch 2011 geprägt hat: die Entweltlichung der Kirche. Es hat damals viel Staub aufgewirbelt, heute verstehen wir es vielleicht besser und tiefer. Der Verweltlichung ist die Profilierung entgegenzusetzen: Die Kirche gewinnt wieder mehr Profil, indem sie einerseits in der Welt ist, aber andererseits durch ihr Innenleben zeigt, nicht von der Welt zu sein. Weltliche Kategorien in der Kirche zu implantieren, hat also Grenzen. Diese abzustecken, darum müssen wir ringen. Sonst sind wir weder Salz noch Sauerteig noch Licht für die Welt.
(Mit freundlicher Genehmigung der "Tagespost")