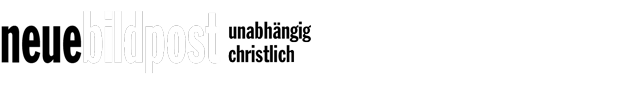Der Priestermangel beschäftigt viele Bistümer in Deutschland. Eine der entscheidenden Fragen, die er aufwirft, dürfte jene sein, wer zukünftig die Gemeinden leiten soll. Pastoralreferentinnen? Ehrenamtliche? Während mancherorts noch Modelle entwickelt und diskutiert werden, gehen andere als pastorale Pioniere voran.
Das Medienecho war groß, als im November der erste Laie die Leitung einer Pfarrei im Bistum Osnabrück übernahm. Schließlich kann Michael Göcking durchaus als Pionier bezeichnet werden. Der Pastoralreferent gab damals Interviews im Fernsehen und für diverse Hörfunk-, Online- und Print-Publikationen. „Michael Göcking: Erster Laienpriester Deutschlands“, titelten Zeitungen. Woanders las man: „Erster Laie wird Pfarrer.“
Wenn er sich an solche Schlagzeilen erinnert, muss der Pastoralreferent heute schmunzeln. Zuerst hätten ihn die Überschriften schockiert. Wie würden Priester oder Bischöfe darauf reagieren? Heute zeigt er sich gelassen: „Mit dem Begriff Pfarrbeauftragter kann keiner etwas anfangen. Da kann man sich unter Laien-Priester schon mehr vorstellen.“ Auch wenn er natürlich kein Priester ist.
Chef von 70 Angestellten
Als Pfarrbeauftragter leitet der 60-Jährige zwei Pfarreien mit etwa 7000 Katholiken. Mit im Seelsorgeteam sind drei Pastoralreferentinnen und zwei Priester, von denen einer die Rolle des moderierenden Priesters einnimmt. „Ich bin derjenige, der hier alles unterschreibt“, fasst Göcking seine Aufgaben kurz zusammen. Außerdem sei er für die Kirchenvorstände zuständig und habe Personalverantwortung für die etwa 70 Angestellten der Pfarreien.
Auch im liturgischen Bereich arbeitet er mit. Er führt das Seelsorgeteam, leitet Beerdigungen und übernimmt außerhalb der Heiligen Messe auch mal die Predigt. Der moderierende Priester hingegen ist „Rektor“ der Kirche und hat damit die sakramentale Verantwortung, beschreibt Göcking. In dem Pilotprojekt ist der moderierende Priester zudem Offizial des Bistums. Diese Verbindung begrüßt Göcking, stehe das Modell doch so auch aus kirchenrechtlicher Sicht auf sicheren Füßen.
Ein solches Leitungsmodell auf den Weg zu bringen, sei schon länger in der Bistumsleitung überlegt worden. Im März 2018 wurde schließlich eine Steuerungsgruppe gebildet, die sich mit der Umsetzung beschäftigte. Neben Göcking, dem moderierenden Priester und Vertretern der Bistumsleitung sind dort auch Mitglieder der Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte der Pilot-Pfarreien beteiligt.
„Wir haben hier bisher lediglich Strukturfragen geklärt, keine inhaltlichen“, betont Göcking. Daher sei es wichtig, dass er mit dem moderierenden Priester in engem Kontakt stehe: „Wir haben bestimmt Dinge, da müssen wir die Zuständigkeiten erstmal gemeinsam besprechen.“ Ohne dieses kollegiale Miteinander würde das Modell nicht funktionieren. „Wenn wir beide uns verzoffen, ist hier Schluss“, zeigt sich Göcking überzeugt.
Bisher seien sie auf einem sehr guten gemeinsamen Weg. Auch bei den Ehrenamtlichen spüre er „eine richtige Aufbruchsstimmung“. Dass es in unterschiedlichen Bistümern aktuell unterschiedliche Ansätze gibt, auf den Priestermangel zu reagieren, begrüßt der Pastoralreferent. „Ich finde es gut, dass wir im Bistum Osnabrück versuchen, neue Wege der Leitung zu gehen, anstatt riesige Gemeinden zu konstruieren.“ Er merke, dass für viele Menschen das Gesicht und die Ansprechbarkeit vor Ort wichtiger sind als allein die Frage der Weihe.
Eine Tatsache ist für den Familienvater nicht von der Hand zu weisen: „Ich bin ein Lückenbüßer.“ Wenn es genug Priester geben würde, wäre er nicht gefragt worden, ob er eine Gemeinde leiten würde, ist er sich sicher. Aber: „Mit dieser Rolle kann ich gut leben.“ Für ihn waren die Voraussetzungen entscheidend, um den Posten anzutreten. So gebe es in der Pfarrei mit dem verhältnismäßig großen Seelsorgeteam gute personelle Voraussetzungen, um Neues auszuprobieren. Wichtig war Göcking auch, dass er weiterhin in der Seelsorge tätig sein könne.
„Für mich heißt Leitung nicht nur Verwaltung, sondern auch Gestaltung der pastoralen Ausrichtung“, sagt er. Daher sollte ein Pfarrbeauftragter nach seiner Ansicht auch idealerweise Seelsorger sein. Er gibt aber zu bedenken: „Wenn der Priestermangel weiter zunimmt und dieses Modell flächendeckend zum Tragen kommt, muss man sich auch damit auseinandersetzen, wie die sakramentalen Aufgaben in den Pfarreien künftig wahrgenommen werden können.“
Gesellschaftlicher Wandel
Dass die Kirche hierzulande überhaupt zu einem solchen Wandel gedrängt wird, liegt insbesondere am Wandel in der Gesellschaft. Studien belegen, dass institutionalisierter Glaube für die Menschen immer unwichtiger wird. Viele seien nicht glücklich über diesen Wandel, ist sich Meinolf Winzeler sicher. „Ich auch nicht.“ Winzeler ist Pfarrer in Rheine im Bistum Münster.
„Bei aller Belastung, die der Umbruch mit sich bringt, sehe ich das als sehr große Chance“, sagt Winzeler. Dadurch werde es möglich, Reformideen umzusetzen, die bereits das Zweite Vatikanische Konzil formuliert habe, die aber „leider lange behindert wurden“. So könne „eine klerikale Kirche überhaupt nicht mehr überleben – es sei denn, sie schrumpft sich zurecht auf einen Sakristeischrank“, glaubt Winzeler. „Und das kann ja keiner wollen.“
Für den Priester ist entscheidend, „in dieser Umbruchszeit“ die Pfarrei als Team zu verstehen. „Wir brauchen die Beteiligung Vieler“, meint er. Macht und Entscheidungsbefugnisse müssten geteilt werden. „Das betrifft mich als Pfarrer natürlich sehr stark.“ Er müsse seine Leitungsbefugnis neu ausrichten. Es gelte nun, der Pfarrei einen Rahmen zu geben, in dem sich Vielfalt entwickeln kann.
Die Beteiligung der Laien – das allgemeine Priestertum, zu dem alle Getauften und Gefirmten berufen sind –, komme zum Zuge, wenn Hauptamtliche es ermöglichten. „Darin sehe ich zurzeit meine Hauptberufung“, sagt der 66-jährige Winzeler, der Mitglied im Diözesan- und im Priesterrat des Bistums Münster ist.
Seit der Fusion 2014 gehören gut 19 000 Katholiken zu seiner Pfarrei St. Antonius in Rheine. Dort denke man das „große System der Pfarrei“ nicht als eine einzelne Gemeinde, sonderen als administrativen Rahmen, der viele Gemeinden ermöglicht. „In unserer großen Pfarrei haben wir etwa 20 Basisgemeinden“, erklärt Winzeler. In ihnen werde die Leitung auch durch Laien wahrgenommen.
Unter den „Basisgemeinden“ sind mehrere Orts-Gemeinden, zehn Kita-Gemeinden, eine Schul-Gemeinde und eine Gemeinde im Seniorenzentrum. Außerdem sei ein Verband auf dem Weg, sich als Personal-Gemeinde zu sehen und dort ehrenamtliche Leitungen zu etablieren. Dieses veränderte Verständnis des Gemeindebegriffs sei Ergebnis eines langen Übungsprozesses. „Aber es funktioniert. Und das ist sehr beglückend“, sagt der Pfarrer.
Winzeler versteht die Pfarreileitung als runden Tisch zwischen Pastoralteam, Kirchenvorstand und Pfarreirat – „unbeschadet der hierarchischen Funktion des leitenden Pfarrers“ auf Augenhöhe. Die Pfarreileitung sei Service-Station sowohl für die Anfragen von außen, als auch für die Engagierten in der Pfarrei. „Wir müssen vor allem ermöglichen, dass im Rahmen dieser Pfarrei Gemeinden aufleben können.“
Ehrlich beteiligen
Seine Erfahrung zeige, sagt Winzeler, dass dadurch „kirchliches Leben in einer größeren Vielfalt stattfindet, als es vorher überhaupt möglich war“. Dazu sei es notwendig, die Menschen auch ehrlich zu beteiligen. „Wenn die Leute merken, dass sie wirklich gestalten dürfen, dann haben sie auch Freude daran, sich zu engagieren.“ Es gelte dann zu schauen: „Wo landen wir, wenn wir gemeinsam die Spur Jesu aufnehmen?“
Das sei ein Prozess von Werden und Vergehen, „den keiner von uns steuern kann“, erklärt der Pfarrer. Daher appelliert er: „Wir brauchen Risikofreudigkeit in einer Situation, in der noch niemand weiß, was dabei herauskommt.“ Besonders wichtig sei ein Bewusstsein, Fehler machen zu dürfen. „Fehlerfreudigkeit ist in so einer Lage ganz wichtig“, sagt Winzeler.
Martin Schmitz