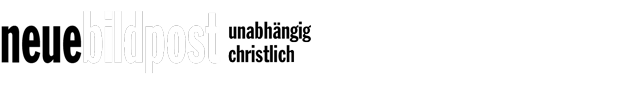Stets am 24. März weist der Welttuberkulosetag auf die verheerenden gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Tuberkulose hin. Das Datum markiert den Tag im Jahr 1882, an dem Robert Koch bekanntgab, dass er das Bakterium entdeckt hatte, das die „Schwindsucht“ verursacht. Dies öffnete den Weg zur Diagnose und Heilung der Krankheit. Ein Blick nach Nigeria zeigt, dass die Krankheit allen Medikamenten und Impfungen zum Trotz auch heute noch ein Problem darstellt.
Schwester Virginia Okolo ist der gute Geist der Tuberkulose-Patienten des Annunciation-Krankenhauses in Enugu, einer Großstadt mit mehr als 700 000 Einwohnern im christlichen Süden Nigerias. Über 30 Patienten warten vor der Tuberkulose-Station des Krankenhauses auf ihren Beistand. Es sind die Ärmsten der Armen, die sich mit Tuberkulose infiziert haben.
Allein schon die Fahrt zum Krankenhaus ist aufwendig und teuer. Sie kostet nur ein paar nigerianische Naira – aber für viele Menschen ist selbst das unerschwinglich. „Wir nehmen auch Patienten auf, die kein Geld haben“, sagt Verwaltungsleiterin Onyia Ifeomachukwu, Ordensschwester vom katholischen Orden „Töchter der göttlichen Liebe“.
„Ich liebe meinen Job“
Sie selbst wurde in einer Missionsschule erzogen. „Mir gefiel, wie die Lehrerinnen Mädchen behandelten, sie ermutigten, ihren Weg zu gehen und sich nicht beirren zu lassen“, sagt die nigerianische Missionarin. „Sollte ich einmal wiedergeboren werden, würde ich diesen Weg erneut gehen. Ich liebe meinen Job“, sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht.
Pflegedienstleiterin im Annunciation-Krankenhaus ist Edith Egbuogu, ebenfalls Ordensschwester der „Töchter der göttlichen Liebe“. Sie hat 26 Jahre in Deutschland gelebt und wurde 2016 in ihr Heimatland Nigeria zurückgeschickt. Die Situation in ihrer früheren Wahlheimat verfolgt sie mit großem Interesse. Sie sagt, sie würde jeden ihrer Landsleute, der sich mit dem Gedanken an Flucht oder Auswanderung trägt, abraten.
„Viele von hier wollen weg und haben Fluchtgedanken, aber die Reise nach Europa und in eine ungewisse Zukunft ist doch viel zu gefährlich“, sagt sie in akzentfreiem Deutsch. Ihre Hebammen-Ausbildung hat die katholische Missionsschwester in Freiburg absolviert. Später hat sie in der Geburtshilfe in Bad Kreuznach gearbeitet und war Regionaloberin ihres Ordens in Rheinbach bei Bonn.
Egbuogu kennt die Unterschiede in der Patientenversorgung beider Länder. „Hier gibt es, wenn überhaupt, nur eine ganz minimale Krankenversicherung, die sich nur die Reichen leisten können. Die wenigsten können ihre medizinischen Untersuchungen selbst bezahlen, da muss dann schon die ganze Familie zusammenlegen.“
Hilfe aus Deutschland
Unterstützung erhält die Annunciation-Klinik durch RedAid Nigeria, eine Partnerorganisation des in Würzburg ansässigen Hilfswerks „DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe“. RedAid unterstützt nicht nur das Handeln der Schwestern zum Wohle der Erkrankten, sondern fördert auch entsprechende Schulungen des Klinik-Personals.
„Immer noch warten Tuberkulose-Kranke zu lange, bis sie medizinische Hilfe aufsuchen, auch weil sie aufgrund fehlenden Wissens falsche Krankheitsursachen vermuten“, sagt Ezeakile Okechukwu von RedAid Nigeria. Man setze auch auf Prävention der Familienmitglieder und eine verstärkte Nachsorge. „Durch die zielgerichtete Aus- und Weiterbildung von Gesundheitspersonal schließen wir Lücken in der Tuberkulose-Bekämpfung. Wir hoffen, mit dieser Strategie die Krankheit langfristig in den Griff zu bekommen.“