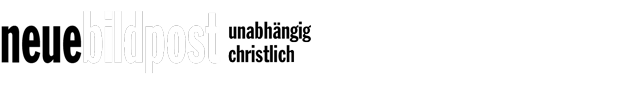Im Blickpunkt
Vor 30 Jahren, am 1. Mai 1994, starb der brasilianische Formel-1-Pilot Ayrton Senna da Silva beim Großen Preis von San Marino in Imola. Er wurde nur 34 Jahre alt. Senna war nicht nur einer der charismatischsten Akteure in der Königsklasse des Motorsports, sondern auch ein gläubiger und bibelfester Rennfahrer, dem die Beziehung zu Gott sehr wichtig war.
Ein Top-Politiker, den jeder kennt, nicht nur wegen seiner mächtigen Augenbrauen: Theo Waigel. Der frühere Bundesfinanzminister und CSU-Vorsitzende, heutiger Ehrenvorsitzender, der mit seiner Frau, dem einstigen Skiass Irene Epple, nun im Ostallgäu lebt, kam am 22. April vor 85 Jahren in Oberrohr bei Krumbach zur Welt. Seiner schwäbischen Heimat war er immer eng und hilfreich verbunden, ebenso der Kirche. Das Interview gibt Einblick, was Theo Waigel im Innersten bewegt.
Initiativen, Organisationen und Vereine, die sich für die Demokratie einsetzen, sollen vom Staat künftig besser gefördert werden. Dies sieht der Entwurf eines Demokratiefördergesetzes von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) vor. Hildegard Schütz, Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Augsburg, sieht das als Eingriff in die freie, öffentliche Meinungsbildung.
Claude Monet (1840 bis 1926) gehört zu den Künstlern, deren Werke fest in der Populärkultur verankert sind. Ähnlich wie Vincent van Goghs „Sonnenblumen“ oder Michelangelos sixtinische Engel finden sich Monets Seerosen oder auch sein Mohnblumenfeld nicht nur in Museen wieder, sondern auch auf Regenschirmen, Notizbüchern und vielem mehr. Die Faszination von Monets Werken transportiert die internationale Ausstellung „Monets Garten“, die derzeit in verschiedenen deutschen Städten gastiert, mit moderner Technik ins 21. Jahrhundert.
Eine Vertonung der Gefängnis-Briefe von Max Josef Metzger wurde bei seiner Bischofsweihe auf ausdrücklichen Wunsch vorgetragen: Bertram Meier bekannte sich zu dem vor 80 Jahren hingerichteten Priester, als eine Seligsprechung noch nicht absehbar war. Diese steht jetzt durch die Anerkennung als Märtyrer unmittelbar bevor. Im Interview erläutert der Augsburger Bischof die Bedeutung des Glaubenszeugen, der im Bistum bleibende Spuren hinterließ.
Ein Kreuz, eine Kuppel, ein Bibelzitat und jetzt auch noch acht große Statuen von alttestamentarischen Propheten: Das Berliner Stadtschloss ist oft in den Schlagzeilen. Kritiker aus Politik und Medien stoßen sich an der christlichen Symbolik. Karl Birkenseer, Redakteur unserer Regensburger Ausgabe, kommentiert die Aufregung.
Sie erfand und moderierte das ZDF-Frauenjournal „ML Mona Lisa“, berichtete vom Balkan, aus Tschetschenien und Gaza und leitete das ZDF-Auslandsstudio in London, bevor sie bis zu ihrem Ruhestand 2010 an der Verwaltungsspitze des NDR stand: Maria von Welser war einst ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Im Exklusiv-Interview erzählt die 77-jährige Trägerin des Bundesverdienstkreuzes von ihrem Glauben, ihren Gebeten und der zeitlosen Bedeutung der Zehn Gebote.
Gut drei Jahre liegt die Schließung der Benediktinerinnenabtei Säben zurück. Nun werden in der Klosteranlage auf dem erhaben wirkenden Felsen hoch über Klausen im Südtiroler Eisacktal bald wieder Heilige Messen zelebriert und Pilger empfangen. Zisterziensermönche aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien werden in Kloster Säben einziehen und wirken.
Ein vom Krieg gezeichneter Lehrer, für den mit seinem kleinen Sohn die eigene Kindheit wieder lebendig wird. Und ein Illustrator auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Beide sind sich nie begegnet und schaffen doch gemeinsam ein großes Werk für die Kleinen: Vor 100 Jahren erschien der Kinderbuchklassiker „Die Häschenschule“, der über Generationen für einprägsame Ostermotive sorgte.
Stets am 24. März weist der Welttuberkulosetag auf die verheerenden gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Tuberkulose hin. Das Datum markiert den Tag im Jahr 1882, an dem Robert Koch bekanntgab, dass er das Bakterium entdeckt hatte, das die „Schwindsucht“ verursacht. Dies öffnete den Weg zur Diagnose und Heilung der Krankheit. Ein Blick nach Nigeria zeigt, dass die Krankheit allen Medikamenten und Impfungen zum Trotz auch heute noch ein Problem darstellt.
Im Nahen Osten ist Krieg. Auch die christliche Minderheit ist davon betroffen: Das Weihnachtsfest fand nahezu ausschließlich im Privaten statt. Alle öffentlichen Feierlichkeiten waren abgesagt. Auch vor Ostern herrscht vielerorts gespenstische Ruhe. Einen Kontrapunkt der Hoffnung setzte ein Kinderkreuzweg auf der Via Dolorosa. Rund 1000 junge Leute beteten so um Frieden im Heiligen Land.
Über 500 Seiten umfasst alleine der Ausstellungskatalog. „Wer seine Werke sehen will, braucht viel Zeit“, sagt eine ältere Dame in der Schlange beim Einlass. „Und einfach hinfahren und Ticket kaufen – das geht auch nicht.“ Sie hat schon vor Wochen für sich und ihren Mann eine Karte für ein Zeitfenster erworben: für die Sonderschau „Caspar David Friedrich – Kunst für eine neue Zeit“. Zu sehen ist sie in der Kunsthalle Hamburg.
In Frankfurt am Main wurde zum Beginn des Ramadan eine bedeutende Straße im Stadtzentrum festlich beleuchtet. Andere Städte wollen folgen. Karl Birkenseer, Redakteur der Regensburger Ausgabe der Katholischen SonntagsZeitung, sieht das kritisch.
Wenn das nur so einfach wäre. Ein kurzes Streitgespräch, bei dem vor einem großem Publikum deutliche Worte fallen, und der garstige Winter mit Eis, Schnee und kalten Winden ist zu Ende. Stattdessen weht ein laues Lüftchen und der Himmel ist blau – immer exakt drei Wochen vor Ostern. Eisenach in Thüringen heißt so den Frühling willkommen. „Sommergewinn“ heißt das traditionelle Fest.
Er ist eine der schillerndsten Figuren der neueren Kirchengeschichte. Mit vielen Attributen wurde er belegt: Kämpfer und U-Bootkommandant, Preuße und Protestant, Heiliger und Haudegen, Verkündiger und Demagoge, Seeteufel und Friedensengel, Widersacher und persönlicher Gefangener Adolf Hitlers, Gewissen der Nation. Vor 40 Jahren, am 6. März 1984, starb Pastor Martin Niemöller.
Einige Lehrer wollen das nach Otfried Preußler benannte Gymnasium in Pullach bei München umbenennen. Sie stoßen sich daran, dass der Schriftsteller im Dritten Reich Mitglied der HJ gewesen war. Im Roman "Erntelager Geyer" habe er Nazi-Gedankengut beschönigt. Bernd Posselt, der seit Jahrzehnten in der Europapolitik tätig sowie Präsident der Paneuropa-Union Deutschland und Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe ist, erläutert in seinem Kommentar, weshalb er solche Umbennungen kritisch sieht.
Die Symbolkraft des Lichts verbindet Völker, Kulturen und Religionen. Licht steht für Frieden und Zuversicht, einen leuchtend-hellen Glauben, für die Hoffnung auf eine strahlende Zukunft. Licht gibt Wärme, spendet Trost und verheißt Glück. Unter diesen Vorzeichen stehen auch die traditionellen Laternenfestivals in Asien, darunter jene auf Taiwan. An diesem Samstag startet das große „Taiwan Lantern Festival“ in der ältesten Stadt der Insel: in Tainan.
Am 15. Februar 1944 legen alliierte Bomben das Mutterkloster der Benediktiner auf dem Monte Cassino im Süden Italiens in Schutt und Asche. Dass das wertvolle Kunsterbe der Abtei überlebt, ist einem österreichischen Offizier der Wehrmacht zu verdanken: dem Wiener Julius Schlegel (1895 bis 1958).
Während die Kölner ihren Narrenruf „Kölle alaaf“ sprachgeschichtlich ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen können und ihn als einen frühen Trinkspruch identifiziert haben, tut sich die Forschung bei der Suche nach den Wurzeln des wohl populärsten deutschen Narrenrufs „Helau“ noch immer schwer. Eine Vermutung ist, er könnte vom kirchlichen Lobgesang Halleluja abstammen.
Eine liebevoll arrangierte Sonderausstellung über den bekannten Autor Otfried Preußler (1923 bis 2013) ist derzeit im Isergebirgsmuseum in Kaufbeuren-Neugablonz zu sehen. Konzipiert wurde die Schau in Zusammenarbeit mit dem Sudetendeutschen Museum München und dem Adalbert-Stifter-Verein. Sie entführt anlässlich Preußlers 100. Geburtstags, den er am 20. Oktober 2023 gefeiert hätte, in seine Erzählwelten.
Zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich (1774 bis 1840) erleben die Kunstfreunde in Deutschland ein ganzjähriges Ausstellungsfestival. Ein halbes Dutzend Sonderschauen sind zum Jubiläum des großen romantischen Malers zu sehen. Der Buchmarkt reagiert mit Sachbüchern, die teilweise sogar die Bestsellerlisten erobern. Friedrichs Geburtstag jährt sich erst im September, doch das Jubiläumsjahr hat bereits begonnen.
Wer erinnert sich nicht gerne zurück an die ersten Spielerlebnisse mit Playmobil? Für viele Junggebliebene bleiben sie bis heute begehrte Sammlerobjekte. Der spielerisch-friedliche Siegeszug des deutschen Männlein-Wunders durch die Kinderzimmer hatte paradoxerweise seinen Ursprung im Nahostkrieg und der Ölkrise 1973.
Traditionell dauert die Weihnachtszeit bis 2. Februar, bis zum Fest Mariä Lichtmess. „Kleine Weihnachten“ wird es im Volksmund genannt. In Ebensee am Traunsee im Salzkammergut findet in dieser Zeit die „Kripperlroas“ statt: Jeden Winter können im Museum Ebensee, in der Pfarrkirche und in Privathäusern Weihnachtskrippen besichtigt werden. Teilweise sind die Exponate 200 Jahre alt. In diesem Jahr reiht sich die Schau ins Programm der Europäischen Kulturhauptstadt ein.
Sein Foto ging um die Welt: 2019 gelang Heino Falcke und seinem Team die erste Aufnahme eines Schwarzen Lochs im Weltall. 20 Jahre hatte der deutsche Astrophysiker und Professor an der Radboud-Universität in Nimwegen darauf hingearbeitet, um diesen sichtbaren Nachweis zu liefern. Als gläubiger Christ braucht er allerdings nicht für alles Beweise, macht er im Exklusiv-Interview deutlich. „Nur Gott weiß alles“, sagt er.
In dieser Woche organisieren sich Landwirte und Bauern bundesweit zu einer Protestwoche gegen politische Vorgaben und Sparpläne. Hildegard Schütz, Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Augsburg, erläutert in ihrem Kommentar, weshalb die Proteste und Kundgebungen gerechtfertigt sind.
Eh la la la la …“ – die Schreie der Gaukler sind nicht zu überhören. „Goigglär“ nennen die Einheimischen die beiden kostümierten Burschen mit den geschwärzten Gesichtern: zwei Verrückte, die ein schwarzes Pferdchen durch eine weiße Wüste dirigieren. Zu Mauern getürmt liegt der Schnee, Eis deckt die schmalen Pfade Kippels, des ältesten Dorfs im Schweizer Lötschental. „Attention, attention“ – wie auf dem Basar preisen die Gaukler ihr Pferdchen an, in dem ein Bursche mit kostbarer Krone steckt. „Chinigrossli“ nennen es die Menschen: Königsross. „Tournez, tournez!“ – Gehorsam dreht sich das Ross, streckt der Königsreiter den Umstehenden sein geschmücktes Hinterteil entgegen. Vor allem Damen sind es, die sich für die schönen Bouquets darauf interessieren, die das Ross wie einen Blumengruß offeriert. Die Burschen parfümieren sie inzwischen auch kräftig.
In Marktredwitz, Große Kreisstadt am Rande des Fichtelgebirges, wartet auf Krippenfreunde eine Besonderheit. Der dortige Krippenweg mit über 20 Stationen lädt nicht vorrangig in Kirchen und Museen, sondern in Privathäuser. Das „Krippenschauen“ hat eine lange Tradition und richtet sich nicht nur an Einheimische. Seit 2021 steht die Marktredwitzer Krippenkultur auf der Liste des Immateriellen Erbes in Deutschland.
Wenn es dunkel wird, ziehen am 24. Dezember im unterfränkischen Breitensee verkleidete Jungen und Mädchen von Haus zu Haus und beschenken Kinder. Sie überbringen die Weihnachtsbotschaft von der Geburt Christi in Bethlehem. Vier Kinder sind es, die Verse aufsagen sowie Glanz und frohe Stimmung in die Wohnstuben zaubern. Der alte Brauch des „Christkindlesgehens“ reicht mehr als 500 Jahre zurück – und ist zusehends bedroht.
Für viele gehört er zur Weihnachtszeit wie Christbaum, Krippe und Plätzchen: der Filmklassiker „Der kleine Lord“. Seit 1980 wird er in Deutschland stets kurz vor dem Fest ausgestrahlt. Die Verfilmung eines Werks von Frances Hodgson Burnett erzählt, wie der hartherzige Earl of Dorincourt durch seinen Enkel zu einem weihnachtlich gestimmten, großzügigen Mann wird. Auch im Leben von Darsteller Alec Guinness führten Kinder zu einer bedeutenden Wende – und zu einem „Weihnachtserlebnis“ der besonderen Art.
Rund 600 Sternsinger werden am 29. Dezember zur bundesweiten Eröffnung der 66. Aktion Dreikönigssingen in Kempten erwartet. Sie steht unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.
Alle Jahre wieder laden hierzulande stimmungsvolle Weihnachtsmärkte zum Bummeln ein. Man trifft Freunde, sieht sich um, genießt – und nicht zuletzt: Man kauft ein. Die Tradition des Weihnachtsmarkts ist nicht nur typisch deutsch. Sie ist auch alt. Die Ursprünge reichen bis ins Mittelalter zurück.
Er ist einer der beliebtesten Heiligen, vor allem bei den Kindern: Bischof Nikolaus von Myra. Millionen Kinder werden auch in diesen Tagen wieder in Kindergärten und Schulen Besuch von ihm erhalten oder ihn auf Christkindles- und Weihnachtsmärkten antreffen. Der gute Bischof wird wie jedes Jahr freundliche und vielleicht auch ein paar mahnende Worte an die Kinder richten und ihnen kleine Geschenke mitgeben. Um den Kindergarten der kleinen österreichischen Gemeinde Plainfeld bei Salzburg könnte der Nikolaus allerdings in diesem Jahr möglicherweise einen Bogen machen: Die Leitung wollte ihn ausladen. Victoria Fels kommentiert.
Es ist Krieg im Nahen Osten. Zwar beschränkt sich die Eskalation des Konflikts gegenwärtig auf den Gazastreifen. Doch auch im Westjordanland ist die Lage angespannt. Adventliche Stimmung? Bei vielen Fehlanzeige. Jesu Geburtsort Bethlehem verzichtet sogar auf Weihnachtsdeko. Dabei hatten viele Christen im Heiligen Land so sehr gehofft, den Advent und das Fest der Geburt des Erlösers nach der überstandenen Corona-Zeit wieder normal begehen zu können.
Gemeinsam mit dem bayerischen Pilgerbüro hat die Diözesanpilgerstelle Augsburg Gläubigen aus der Diözese Augsburg eine ganz besondere Wallfahrt mit Bischof Bertram Meier an die Nordseeküste geboten. Ziel der Gläubigen aus dem Bistum des heiligen Ulrich war die nördlichste Ulrichskirche Deutschlands.
2016 hat der Papst den Welttag der Armen ins Leben gerufen. Er findet mittlerweile auf dem ganzen Erdball Beachtung und wird immer am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres gefeiert. Für diesen Sonntag, den 19. November, hat der Pontifex aus dem Buch Tobit (4,7) die Stelle gewählt: „Wende dein Angesicht von keinem Armen ab.“ An der Eucharistiefeier mit dem Heiligen Vater werden vermutlich wie in den Vorjahren zahlreiche Arme und Bedürftige teilnehmen.
Den Kirchen in Deutschland steht ein Absturz bevor. In 20 Jahren haben sie vielleicht die Hälfte ihre Mitglieder verloren. Was danach kommt, ist ungewiss. Die katholische ist noch gefährdeter als die evangelische. Das geht aus der am 14. November veröffentlichten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) hervor. Die katholische und die evangelische Kirche haben sie gemeinsam in Auftrag gegeben.
Ihre Zahl hat durch den immer stärker motorisierten Verkehr in den zurückliegenden Jahren zwar deutlich abgenommen. Doch in zahlreichen Städten Indonesiens prägen Becaks das Straßenbild noch immer. Als Becak (sprich: Betscha) bezeichnet man ein pedalgetriebenes Fahrzeug mit drei Rädern. In Europa ist es besser unter seinem japanischen Namen bekannt: Rikscha.
Am Anfang stand ein kleines Männlein mit Knollennase. Es entsprang seiner Feder, er hegte und pflegte es, und es brachte ihm Glück: Feinsinnige Ironie und Sprachwitz, eine scharfe Beobachtungsgabe und ein untrügliches Gespür für Situationskomik, das waren Loriots Markenzeichen. Der Karikaturist, Autor, Regisseur und Schauspieler gilt bis heute als genialster Humorist deutscher Sprache.
Der blutige Hamas-Überfall auf Israel hat die ganze Welt schockiert. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann ordnet den Terror im Interview ein und zeigt auf, in welcher Sackgasse der Friedensprozess in Nahost nicht erst seit der jüngsten Eskalation steckt.
Vier Wochen lang war Bischof Bertram Meier Geheimnisträger, denn Papst Franziskus wünschte sich die Weltsynode als „Schutzraum“ – auch gegenüber der Presse. Zum Abschluss der ersten Runde zieht der Augsburger Oberhirte und Weltkirchebischof als einer von drei Gesandten der Deutschen Bischofskonferenz für unsere Zeitung ein erstes Fazit.