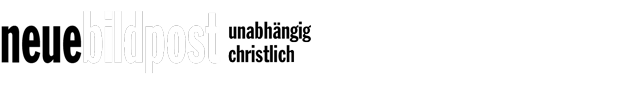Dokumentation
Die Kirche lehnt Leihmutterschaft und medizinische Geschlechtsumwandlungen ab. Zudem bleibt sie bei ihrem strikten Nein zu Abtreibung und Sterbehilfe. Ihre Position begründet sie in einer am Montag im Vatikan veröffentlichten Erklärung mit der Pflicht zur Verteidigung der von Gott gegebenen Menschenwürde. Das rund 25 Seiten lange Papier wurde vom Präfekten des Glaubensdikasteriums im Vatikan, Kardinal Victor Fernandez, unterzeichnet und von Papst Franziskus am 25. März genehmigt.
Ab sofort gibt es auch eine deutsche Fassung des Schlusstextes der ersten Phase der Weltsynode. Das 40 Seiten umfassende Dokument ist in 20 Kapitel gegliedert und enthält insgesamt 270 Unterpunkte. Diese wurden von den 346 Synodalen im Vatikan am Samstag nach vierwöchigen Debatten alle einzeln abgestimmt. Jeder der Punkte erhielt eine Mehrheit von mindestens 80 Prozent.
Die Geographie der Kirche wandelt sich, Europa relativiert sich. Transformation! Im Netz der Weltkirche ist die Kirche in Deutschland ein kleiner Knoten, der beachtet wird. Unsere Verantwortung liegt darin, uns einzubringen und in der Einheit zu bleiben. Was mir bei der Synode besonders hilft, sind die sog. „conferenze nello Spirito (Santo)”, die Gespräche im Heiligen Geist. Wir üben täglich, was es heißt, gut aufeinander zu hören und dabei vor allem den Heiligen Geist zu Wort kommen zu lassen. So wurde diese Synode für mich eine Hörschule der Weltkirche. Diese Hörschule ist ein Impuls zum Gegensteuern, wenn es uns das Maß verzieht. Wenn wir ausrasten, hilft uns das wohlwollende Hören beim Einrasten.
Maria ist uns Vorbild im Glauben. An ihr sehen wir: Gott setzt in Bewegung. Der christliche Glaube ist also nichts „für das Sofa“. Wir Christen haben keinen „Couch-Glauben“, vielmehr sollen wir „Glaubens-Coaches“ sein! Glaube will sich mitteilen, Glaube sucht die Begegnung. Sprechen wir miteinander über das, was uns im Glauben bewegt! Seien wir begeisterte Boten für Jesus Christus! Legen wir Zeugnis ab von der Hoffnung, die uns erfüllt (vgl. 1 Petr 3,15)! Ducken wir uns als Christen nicht weg! Wir brauchen mit dem Evangelium nicht „hinterm Berg zu halten“. Es geht um mutige Verkündigung in glaubwürdigen Worten und sozial-karitativen Werken. Der christliche Glaube ist nicht exklusiv, sondern integrativ und inklusiv. Die Kirche ist kein „Club von Auserwählten“. Sie hat den Auftrag, für alle da zu sein. Der Papst hat in Lissabon klar gesagt: Die Kirche ist offen para todos, für alle, wirklich für alle!
Vor 25 Jahren schrieb Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, den Klerus, die Ordensleute und an die Gläubigen über die Heiligung des Sonntags.
Das Gelingen eines Festes hängt von einer guten Vorbereitung ab. Das gilt ebenso für unser Ulrichsjubiläum. Zwei Jahre lang wurde das Jubiläumsjahr intensiv vorbereitet und organisiert. Ich bin überzeugt, wir sind gut gerüstet für das Festjahr. Wie steht es um unsere eigene geistliche Vorbereitung? Auch hierfür haben wir manches unternommen. Ich erinnere nur an die monatlichen Vorbereitungsgottesdienste in der St. Ulrichskirche in Seeg. Der heutige Umkehr- und Versöhnungsgottesdienst soll nochmals ein letztes Innehalten sein, bevor wir am kommenden Montag mit einer feierlichen Vesper das Ulrich-Doppeljubiläum eröffnen.
Es ist kein Geheimnis: Die hl. Mutter Teresa von Kalkutta war keine Freundin von eigenen Porträtbildern. Nur selten gab sie Fotos von sich selbst an andere weiter. Doch es gibt Priester, die am Anfang ihres Wirkens Mutter Teresa angeschrieben und sie um ein ermutigendes Wort für ihren Start im Weinberg des Herrn baten. Meistens erfüllte Mutter Teresa diesen Wunsch – und sie tat es kurz und knapp mit wenigen Worten: „Be a holy priest!“ – „Seien Sie ein heiliger Priester!“ Diese Worte schrieb die kleine Ordensfrau oft auf ihr Porträtbild.
Lex credendi – lex orandi. Die Weise zu glauben sagt etwas aus über die Art zu beten. Das ist eine alte Faustregel: Sag mir, wie Du betest, und ich sage Dir, was Du glaubst – und umgekehrt. An Fronleichnam wird das offenkundig – öffentlich. Wir zeigen, was wir glauben, durch die Art und Weise, wie wir es nach außen kundtun. Heute bleiben wir nicht in unseren eigenen vier Wänden, wir öffnen die Türen unserer Kirchen und gehen nach draußen. Wir feiern Fronleichnam öffentlich. Wir behalten unseren Glauben nicht für uns, wir zeigen ihn der Stadt – auch denen, die nicht christlich, geschweige denn katholisch sind. Das ist nicht nur eine Demonstration, das ist für viele auch eine Provokation. Wir halten mit unserer Überzeugung nicht hinter dem Berg. Im Gegenteil: Wir zeigen und bezeugen Jesus Christus in einem kleinen Stück Brot, der Hostie.
Ich freue mich, einmal wieder bei einer Landessynode zu Gast zu sein – als ehemaliger Vorsitzender der ACK Bayern entdecke ich hier viele vertraute Gesichter und erinnere mich gerne an gemeinsame Projekte und Wegstrecken. Das Wegmotiv hat in unseren Kirchen seit einiger Zeit erheblich an Bedeutung gewonnen.
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben an den einen Gott,
liebe Freundinnen und Freunde im christlich-muslimischen Dialog!
„Höchster, allmächtiger und guter Herr, Dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehr.“ Das ist der Kehrvers des Sonnengesangs des hl. Franz von Assisi (ungefähr 1181 geboren, 1226 gestorben). Diesen Kehrvers haben wir zu Beginn unseres Abendgebets gemeinsam gesungen. Im Zentrum steht das Lob des einen Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde, wie es im Apostolischen Glaubensbekenntnis heißt. Franz von Assisi (auch bekannt als Franziskus), der im 12. Jahrhundert in Italien lebte, stellt in den Strophen seine Schöpfungs- und Naturmystik in ein ganz besonderes Verhältnis zu sich selbst: Sonne, Mond, Sterne, Wind, Feuer, Wasser, Erde, der Mensch und sogar der Tod – und noch vieles mehr – sind für ihn geschaffen von dem einen Gott, der auch ihn als Menschen, als Franz, geschaffen hat. Deshalb loben sie mit ihm den gemeinsamen Schöpfer und gelten ihm als Geschwister.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe muslimische Gäste,
es freut mich sehr, Sie heute, beim vierten Jahresempfang der Deutschen Bischofskonferenz für die Partner im christlich-islamischen Dialog willkommen heißen zu können! Ein besonderer Gruß gilt allen, die im Theologischen Forum Christentum und Islam mitwirken. Durch Ihre theologische Netzwerkarbeit leisten Sie seit mittlerweile 20 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung des christlich-islamischen Dialogs.
Wie die Heilige Schrift erahnen lässt, was Gottes Wille für die Menschen ist, so zeigt sich in den Suchbewegungen des Volkes Gottes auch, wie sich die Suche nach dem Willen Gottes praktisch vollzieht. Von diesem Mühen gläubiger Suchgemeinschaften ergeben sich Aussagen für unser eigenes Fragen nach dem Willen Gottes. Das ist gelebte synodale Kirche.
Wie gelingt mein Leben? Was ist überhaupt ein „gutes Leben“? Wir Christinnen und Christen gehen von einer wichtigen Voraussetzung aus: Wir haben uns das Leben nicht selbst gemacht. Ein selbstgemachtes Leben – nichts als Mache! Wir haben das Leben empfangen. Unser Leben kommt von Gott! Wir glauben nicht an Zufall, wir vertrauen einem Gott, der ein Freund des Lebens ist. Als solcher haucht er dem Menschen nicht nur den Lebensatem ein: Von der Zeugung bis zum natürlichen Tod sorgt er sich um jede und jeden von uns wie eine zärtliche Mutter und ein liebender Vater. Der Garten Eden, von dem wir in der ersten Lesung aus dem Buch Genesis hörten (vgl. Gen 2,8), ist das Sinnbild einer Schöpfung, die dem Menschen alles bereitstellt, was er zum Leben braucht.
„Bitte wenden!“ Wir kennen diese Aufforderung, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und das Navigationsgerät fast penetrant darauf hinweist, dass man in die falsche Richtung fährt. „Bitte wenden!“ Das ist auch das Motto für die österliche Bußzeit, die heute beginnt. Ich denke an den Ruf des Propheten Joel, den wir in der ersten Lesung hörten: „Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen!“ (Joel 2,12) Im hebräischen Originaltext steht dabei ein Wort (šûb), das man aus heutiger Sicht tatsächlich mit einer 180 Grad-Wende übersetzen könnte. Joel will das Volk Gottes wachrütteln. Er warnt davor, dass die Menschen in Gefahr geraten, wenn sie nicht umkehren und einfach so weitermachen wie bisher. „Kehrt um“ meint eine innere Lebenswende, eine entschiedene Hinwendung zu Gott. Es geht nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern um eine Bekehrung des Herzens und ein Hören auf das Wort Gottes, der uns gnädig ist (Joel 2,13), aber nicht automatisch die Sünden vergibt. (vgl. Joel 2,14). Am Anfang der Fastenzeit kann dieser Aufruf eine Art Stoppschild sein. Stopp, halt an und frage dich: Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Wohin gehe ich und was ist mein Ziel? Viele Menschen machen sich keine Gedanken darüber. Sie leben ihr Leben und gehen stets die Wege nach, die andere schon ausgetreten haben. Mitläufer und Nachläufer gibt es zuhauf. Ich lade Sie ein, nutzen wir die kommenden 40 Tage und fragen uns: Welchem „Navi“ folge ich in meinem Leben?
„Es sind vor allem Benedikts Worte, die bleiben und seinem Wirken einen Stempel aufdrücken, dessen Prägekraft lange wirken wird", sagte Bischof Bertram im Requiem für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. im Augsburger Dom. "Sein besonderes Augenmerk galt zwei großen Themenfeldern: dem Verhältnis von Glaube und Vernunft sowie der Beziehung zwischen Kirche und Welt.“ Im Mittelpunkt standen dabei vor allem das theologische Vermächtnis Benedikts. Verschiedene Sprecher lasen Texte Benedikts aus den Themenfeldern Ökologie, Ehe und Familie, Jugend, Alter, Ökumene sowie Berufung zum Priestertum und zum Ordensleben vor. Bischof Bertram, der die Texte selbst ausgewählt hat, sagte: „So wird Benedikt XVI. uns bei diesem Gottesdienst selbst die Predigt halten.“
Vor gut zehn Jahren (2011) platzte im Konzerthaus in Freiburg eine Bombe. Der Verantwortlich dafür war kein geringerer als der damalige Papst Benedikt XVI., an dem wir heute Abend besonders im Gebet denken. Die versammelten Menschen waren feierlich gestimmt, als der Papst ein Wort ins Spiel brachte, das die Zuhörer überraschte. Viele zuckten zusammen. Manche reagierten schockiert, andere empört. Das Wort ist in der Tat so ungewöhnlich, dass das Korrekturprogramm eines normalen Computers es bis heute als Fehler markiert. Was damals wie eine Bombe einschlug, heißt „Entweltlichung“.
Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist am 31. Dezember 2022 verstorben. Im Nachruf blickt Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz auf Leben und Wirken des ehemaligen Heiligen Vaters zurück.
Bischof Bertram Meier kam zur Wiederweihe der Kirche St. Martin nach Lagerlechfeld. Wer heute in die Kirche geht, lege ein Statement ab, sagte er in der Predigt. "Lassen wir uns nicht beirren, wenn wir Christen wegen unserer Glaubenspraxis schief angeschaut oder belächelt werden!" Sie sollten „Feuer und Flamme“ sein für Jesus.
Sie legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war (Lk 2,7). Eine Ordensgemeinschaft, mit der ich schon als Baby durch das Augsburger Kinderkrankenhaus Josefinum verbunden bin, sind die Franziskanerinnen von Maria Stern. Seit bald 765 Jahren sind Frauen engagiert im Zeichen des Sterns unterwegs, davon 85 Jahre in Brasilien. Im Rahmen eines Jubiläums, an dem ich selbst in Brasilien teilnehmen konnte, zogen die Schwestern durch die Straßen der Stadt Timbaúba. Bei dieser Prozession, die eine Demonstration des Glaubens war, gab es verschiedene Stationen, bei denen das Evangelium in die Gegenwart versetzt wurde.
Das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ ist das gemütvollste Weihnachtslied, das ich kenne. Heute habe ich es mit den Gefangenen in Gablingen schon einmal gesungen, am Ende der Christmette werden wir es gemeinsam anstimmen: „Stille Nacht, heilige Nacht“. In seiner letzten Strophe mündet es ein in den Freuden-Ruf: „Christ, der Retter ist da.“ „Christ der Retter ist da.“ Das ist der Kern der Weihnachtsbotschaft. Im göttlichen Kind im Stall von Bethlehem ist der Welt der Retter geboren. In ihm liegt die Rettung der Menschheit. Wie ist das zu verstehen?
Zum 56. Welttag des Friedens am 1. Januar 2023 fordert Papst Franziskus die Menschen auf, nach der Corona-Pandemie neu zu beginnen, um gemeinsam Wege des Friedens zu erkunden.
Sehr geehrte Frau Schütz, sehr geehrte Vorstandsmitglieder,
sehr geehrte, liebe Mitglieder des Diözesanrates,
einige von Ihnen werden - wie ich - mit freudiger Überraschung aus den Medien erfahren haben, dass wir in der Vorbereitung auf die Weltsynode 2023 wieder einen Schritt weitergekommen sind: Anfang Oktober verabschiedeten die Beauftragten das erste Arbeitsdokument für die kontinentale Phase. Grundlage für diesen Text waren die 112 Synthesen, die seitens der nationalen Bischofskonferenzen eingegangen waren (von insgesamt 114).
Mit dem Ohr des Herzens hören. Um das Hören soll es gehen. Was wir doch nicht alles hören! Was da nicht alles auf uns einströmt! Nachrichten und Informationen rund um die Uhr. Newsletter, Social Media und Internet. So viele Stimmen, Meinungen und Statements: Welche ist richtig? Was sind nur Fake-News? Wo lassen wir uns täuschen?
„Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Darum ist es für jeden Christen und jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort zu verkünden und seinen/ihren Glauben in der Welt zu bezeugen. Es ist jedoch wichtig, dass dies im Einklang mit den Prinzipien des Evangeliums geschieht, in uneingeschränktem Respekt vor und Liebe zu allen Menschen.“
Meine lieben Schwestern und Brüder, mit diesem Brief möchte ich mich an alle wenden - nachdem ich mich nach der Veröffentlichung des Motu Proprio Traditionis custodes bereits eigens an die Bischöfe gewandt habe -, um mit Euch einige Überlegungen zur Liturgie, einer grundlegenden Dimension für das Leben der Kirche, zu teilen. Das Thema ist sehr umfangreich und verdient in all seinen Aspekten eine sorgfältige Betrachtung: Mit diesen Zeilen beabsichtige ich jedoch nicht das Thema erschöpfend zu behandeln. Ich will hier schlichtweg einige Denkanstöße geben, um die Schönheit und Wahrheit der christlichen Feier zu betrachten.
Eigentlich könnten heute Sektkorken knallen: ein großer Tag für unser Bistum. Drei Diakone haben sich entschlossen, die Priesterweihe zu erbitten. Gern erfülle ich diesen Wunsch. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre; als Bischof habe ich mit Freude Ihre Bereitschaftserklärung angenommen, der Kirche von Augsburg als Priester dienen zu wollen. Schön, dass Sie da sind: Roland Kiechle, Markus Kraus und Manuel Reichart. In der Tat: Heute dürfen wir die Sektkorken knallen lassen; heute dürfen wir anstoßen: ein Prosit auf den Herrn Jesus Christus, in dessen Namen ich Sie durch Handauflegung und Gebet weihen darf, ein Prosit auf das Volk Gottes, das auf Sie wartet, ein Prosit auf Ihre Eltern, Geschwister und Freunde, die Sie ins Leben und in den Glauben eingeführt haben, ein Prosit auf den Regens mit seinem Team und ein Prosit auf die Weihekandidaten, dass sie diesen Berufungsweg gehen wollen bis zum Tod.
Strahlen: Dieses Wort ist schillernd. Beim Gedenken an Tschernobyl und Fukushima ist es immer wieder in vieler Munde. Es geht uns durch Mark und Bein, es sitzt uns in den Knochen. Reaktorschock: Jeder weiß, was das bedeutet. Es gibt Strahlen, die schädlich sind, manchmal sogar tödlich. Man sieht sie nicht. Sie liegen in der Luft. Sie verseuchen Pflanzen und Tiere. Auch wenn sie heilen sollen - etwa Bestrahlungen nach schweren Krankheiten, oft zerstören sie Gesundes. Aber es gibt noch eine ganz andere Art Strahlen. Dasselbe Wort und doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es jagt Schrecken ein und weckt Begeisterung. Jeder kennt Menschen, die strahlen, die etwas Besonderes ausstrahlen, die Ausstrahlungskraft besitzen.
Am 24. Mai eines jeden Jahres ruft die katholische Kirche zum Gebet für die Christen in China auf. Der Gebetstag war im Jahr 2007 von Papst Benedikt XVI. am Fest „Maria, Hilfe der Christen“, der Muttergottes von Sheshan, begründet worden. Bischof Dr. Bertram Meier (Augsburg), Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, wendet sich mit diesem Gebetsanliegen an alle Gläubigen: „Setzen wir an diesem Tag gemeinsam ein Zeichen weltkirchlicher Solidarität, indem wir in den Fürbitten unserer Schwestern und Brüder in China gedenken.“
Heute lade ich zu einer Zeitreise ein. Wir starten im Jahr 1638. Mitten im 30jährigen Krieg setzt Kurfürst Maximilian in München einen besonderen Akzent: die Mariensäule als Dank für die Rettung der Städte München und Landshut vor der Zerstörung durch die schwedischen Soldaten. Zugleich will er mit der Weihe der Mariensäule sein Land und seine Regentschaft der Gottesmutter anvertrauen.
Stellen Sie sich vor: Der Papst ist auf Pastoralbesuch in Amerika und fährt an einem freien Nachmittag mit seinem Chauffeur auf der Autobahn durch die Prärie. „Mein Sohn“, sagt er zum Chauffeur, „ich bin zwar der Papst, aber man lässt mich nichts mehr selber machen. Einmal im Leben möchte ich noch selbst Auto fahren. Wechseln wir den Platz! Hier sieht uns niemand.“ Gesagt, getan. Der Papst setzt sich ans Steuer – und fährt, aber leider zu schnell. Er wird gestoppt – von einer Polizeistreife. Der Polizist sieht den ertappten Verkehrssünder, er wird blass und ruft seinen Chef an: „Was soll ich tun?“ „Strafen natürlich“, raunt eine barsche Stimme. „Aber nein, das geht nicht! Es ist eine hohe Persönlichkeit...!“ Der Chef wird stutzig: „Wer soll es denn sein, mitten in der Prärie? Es wird schon nicht der Gouverneur sein.“ Der Polizist entgegnet: „Der Gouverneur? Viel höher!“ Darauf wieder der Chef: „Lächerlich, das wäre ja der Präsident der Vereinigten Staaten.“! „Nein“, unterbricht ihn der Beamte, „viel höher!“ „Machen Sie keine dummen Witze und sagen Sie mir endlich, wer es ist.“ Darauf der Polizist: „Ich weiß es auch nicht, aber der Papst ist sein Chauffeur.“
Es ist Pascha, Vorübergang des Herrn. Die Juden feiern bis heute dieses Fest und denken daran, wie der Herr die Häuser verschont hat, deren Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen waren. Die jüdische Familie versammelt sich zu einem Mahl. Dabei ist es Sitte, dass der jüngste Sohn den Vater fragt: Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen? Der Vater erzählt dann lange Geschichten: von Jahwe, der Welt und Menschen erschaffen hat, von Abraham, von Ägypten, dem Sklavenhaus, und schließlich vom Vorübergang des Herrn: Jahwe verschont die Israeliten und führt sie sicher durch das Rote Meer.
Was ist das typische Kleidungsstück eines Priesters? Die einen werden sagen: das Priesterkollar, ob eher deutsch als Oratorianer oder mehr römisch als hoher Stehkragen. Vor allem die junge Generation des Klerus legt wieder besonderen Wert darauf. Die anderen denken an eine schalartige Textilie, die der Priester anlegt, wenn er offizielle Amtshandlungen vollzieht: die Stola.
Die Stola gehört zur Grundausstattung eines Neupriesters. Es ist fast selbstverständlich, dass ein Primiziant von seiner Verwandtschaft oder von seiner Heimatgemeinde eine Stola geschenkt bekommt: diesen um den Nacken gelegte schmale, edle, prachtvolle Schal, oft edel bestickt und mit Silber- und Goldfäden durchwirkt.
Hochwürdigster Herr Bischof!
Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst! Liebe Schwestern und Brüder!
„Heute kräht kein Hahn mehr danach“, sagen wir manchmal über Sachverhalte, die scheinbar nicht mehr von Interesse sind.
In dieser Woche wurde gemeldet, dass die Zahl derer, die in unserem Land zu einer der großen christlichen Konfessionen gehören, unter die 50%-Marke gesunken ist. Christen -eine Minderheit in unserem Land? Unser Glaube, die Kirche – eine Sache, nach der kein Hahn mehr kräht?
Die Regel des hl. Benedikt gehört zu den großen Büchern des Abendlandes. Sie hat nicht nur das Leben vieler Generationen von Ordensleuten bis heute bestimmt; sie zählt auch zu den Stempeln, die der Kultur des christlichen Abendlandes eingeprägt wurden. Die Benediktsregel beginnt mit einem Prolog, und darin steht der Satz: „Lasst uns endlich aufstehen, die Schrift weckt uns“.
Nachrufe
Helmut Mangold
In der Nacht zum 3. November ist Helmut Mangold im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.
Getragen von seinem festen Glauben, befeuert vom frischen Wind des zweiten Vaticanums hat sich Helmut Mangold ein Leben lang in unserer und für unsere Kirche engagiert.
Als junger Mann hatte er den Bläserkreis St. Ulrich in der Basilika St. Ulrich und Afra gegründet. Sein Leben lang hatte er die Orgel in seiner Heimatgemeinde Aufheim gespielt und als Chorleiter mit seinem Kirchenchor die Gottesdienste umrahmt. Genauso umrahmte er musikalisch auch stets die Gottesdienste bei den Vollversammlungen des Diözesanrates.
1971 wurde Helmut Mangold zum Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates seiner Heimatgemeinde St. Johann Baptist in Aufheim gewählt und blieb es bis 2006, Mitglied des Pfarrgemeinderates bis 2014.
43 Jahre lang war er Vorsitzender des Dekanatsrates Neu-Ulm.
Von 1982 bis 2018, 35 Jahre lang, war Helmut Mangold Mitglied des Diözesanrates der Katholiken und seines Vorstandes, sowie zahlreicher Sachausschüsse.
1990 wurde er stellvertretender Vorsitzender, 1994 Vorsitzender des obersten Laiengremiums im Bistum Augsburg und blieb es 20 Jahre lang.
Seit 1986 war er Mitglied im Landeskomitee der Katholiken in Bayern und wurde von 2001 bis 2009, zwei Wahlperioden lang, zu dessen Vorsitzendem gewählt.
Von 2002 bis 2018 gehörte er dem Zentralkomitee der Katholiken an.
Thematisch lagen Helmut Mangold die Ökumene und die Medienarbeit besonders am Herzen. Schon früh hatte er erkannt, dass Vernetzung sowohl zwischen den christlichen Konfessionen als auch in der kirchlichen Medienarbeit unerlässlich für unsere Kirche ist.
Für seinen Einsatz im Bereich des kirchlichen Ehrenamtes wurde Helmut Mangold mit der Auszeichnung „Pro Ecclesia et Pontifice“ und mit der Franz Eser Medaille geehrt.
Seiner gewaltigen und unschätzbaren Leistung im Bereich des kirchlichen Ehrenamtes können wir nur sehr dankbar und demütig begegnen. Sein überzeugender Einsatz für die Menschen, für die Gremien und für unsere ganze Kirche hat viel Segen gebracht.
Persönlich erlebte ich Helmut Mangold stets als einen offenen, menschenfreundlichen, geradlinigen, toleranten, kommunikativen, warmherzigen und interessierten Menschen mit einem unnachahmlich ausgleichenden und vermittelnden Wesen.
Als seine Nachfolgerin im Vorsitz des Diözesanrates konnte ich mich stets auf seinen fundierten, vertrauensvollen und ehrlichen Rat verlassen, wenn ich darum gebeten habe.
A
Die Kirche von Augsburg – verflochten in die Krisen von Welt und Kirche:
Drei Baustellen betreffen uns hautnah: die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und der Synodale Weg. Diese Themenfelder zwingen uns zu Lösungen, die wir nur bedingt lösen können durch Organisation, genauso wichtig ist Improvisation. Christlich gewendet: Trauen wir dem Heiligen Geist!
Als Teilkirche in Deutschland sind wir verflochten in das Netz der Weltkirche. Es wird keinen Augsburger Sonderweg geben können, wenn wir katholische Ortskirche (Diözese) bleiben wollen.
Die Ukraine durchlebt dramatische Tage: Tage des Krieges, Tage des menschlichen Leids. Soldaten auf beiden Seiten der Front werden getötet und verwundet. Auch viele Zivilisten sind unter den Opfern, weil Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser von Bomben und Raketen getroffen werden. Allen Regeln der Einhegung von Kriegshandlungen zum Trotz werden die zivilen Opfer in Kauf genommen, sehr wahrscheinlich sogar zur Einschüchterung und Demoralisierung der Bevölkerung bewusst herbeigeführt. Bereits in den wenigen Tagen, die dieser Krieg andauert, sind Tausende Menschen gestorben. Unzählige mehr haben den Tod von Angehörigen zu beklagen, ihr Hab und Gut verloren und wurden ihrer Lebenschancen beraubt. Viele haben Traumata erlitten, von denen sie sich erst nach sehr langer Zeit werden erholen können. Wahrscheinlich sind schon mehr als zwei Millionen Menschen auf der Flucht ins Ausland. Die Schneise der Verwüstung, die der Krieg in kürzester Zeit geschlagen hat, ist riesig.
Lesung: 1 Petr 2,4-9
(„Lasst euch als lebendigeSteine zu einem geistigen Hausaufbauen“)
_________________________________
Liebe Schwestern und Brüder,
„Warum bleiben, wenn die Kirche zum Davonlaufen ist?“ Das fragen heute viele – auch treue Christinnen und Christen, die der Kirche verbunden sind. Vor einem Jahr wurden bei einem Podcast der AZ der evangelische Regionalbischof Axel Piper und ich ganz unverhohlen gefragt, ob es die Kirche denn überhaupt noch braucht. Welche Existenzberechtigung hat eine Institution, die sich in den Augen vieler selbst abgeschafft hat? Wir machen Schlagzeilen, aber negative. Finanzskandale, Missbrauchsfälle, sexualisierte Gewalt und andere Missstände haben unsere Glaubwürdigkeit nachhaltig erschüttert. Die Folge bei vielen: Wut und Entfremdung. Seit Jahren verzeichnen die beiden großen Kirchen Rekordwerte bei den Austrittszahlen. Manchen erscheint die Kirche als Schiff im hohen Wellengang: Die Kirchentitanic geht unter! War’s das? Ende der Fahnenstange? Mission gescheitert? Sie werden nicht überrascht sein, wenn ich anderer Meinung bin: Trotz aller Fehler, ja Verbrechen in der Kirche ist es ein Segen, dass es Kirche(n) gibt und warum es sie auch zukünftig braucht. Zuerst möchte ich darlegen, was wir eigentlich meinen, wenn wir von „der Kirche“ sprechen.
Da sage noch einer, Religion sei out. Wenn man jüngste Äußerungen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hört, dann liegt das Gegenteil nahe: Religion ist in. So hat der Politiker erst am 4. Dezember auf einem Parteitag der Grünen Corona als „Plage biblischen Ausmaßes“ bezeichnet und hinzugefügt: „Ich bin weder der Pharao, der unterdrückt, noch der Mose, der befreit.“ Weiter sagte Ministerpräsident Kretschmann. „Das Impfen ist der Moses, der uns aus dieser Pandemie herausführt.“ - Wie immer man diese Aussagen drehen und wenden mag, religiöse Narrative werden durchaus noch bemüht, um aktuelle Phänomene zu beschreiben. Doch für solche Zeitanalysen muss man bibelfest sein. Auch der 1. Petrusbrief, aus dem wir in der Lesung hörten, kann uns helfen, die gegenwärtige Phase der Geschichte zu würdigen, über der schon jetzt bald zwei Jahre ein Schatten liegt: „Dennoch seid ihr voll Freude, wenn es für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen.“ (1 Petr 1, 6f.)
Womit fängt es an, das Johannes-Evangelium? „Im Anfang war das Wort.“
Was fangen wir damit an? Können wir überhaupt etwas damit anfangen?
Wir sprechen eine andere Sprache: „Im Anfang war die Tat.“ So lesen wir bei Johann Wolfgang von Goethe als Inbegriff neuzeitlichen Selbstbewusstseins. Es ist eine erregende Szene, die der große Dichter und Denker da beschreibt: Faust denkt nach über dieses Evangelium vom Anfang: „Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat.“ Doch unmittelbar nachdem das getrost geschrieben ist, erscheint der Teufel auf der Bühne: Es ist eine teuflische Sache, wenn die Welt (und auch die Kirche!) ein Produkt der eigenen Tat wird, wenn der Mensch sich selbst macht: Der „gemachte Mann“! Doch wehe ihm, wenn er merkt, dass alles nur Mache war! Übrigens auch in der Liebe: Wir können es uns nicht selbst besorgen. Liebe können wir uns nicht selbst machen.
„Hier sitz’ ich, forme Menschen nach meinem Bilde ...“ (Prometheus). Dann haben wir die Bescherung: schöne Bescherung, aber nicht weihnachtlich! Wenn am Anfang die Tat steht, dann wissen wir am Ende nicht mehr, wo wir anfangen sollen und dürfen und vor allem auch, wo wir aufhören müssen. Eine Frucht dieser Einstellung ernten wir in den Diskussionen, die uns bewegen: Wo beginnt menschliches Leben und wo hört es auf? Was tun mit Embryonen, von denen man glaubt, dass es Menschen mit Behinderung werden? Was tun mit Pflegebedürftigen, die jahrelang dahinvegetieren?